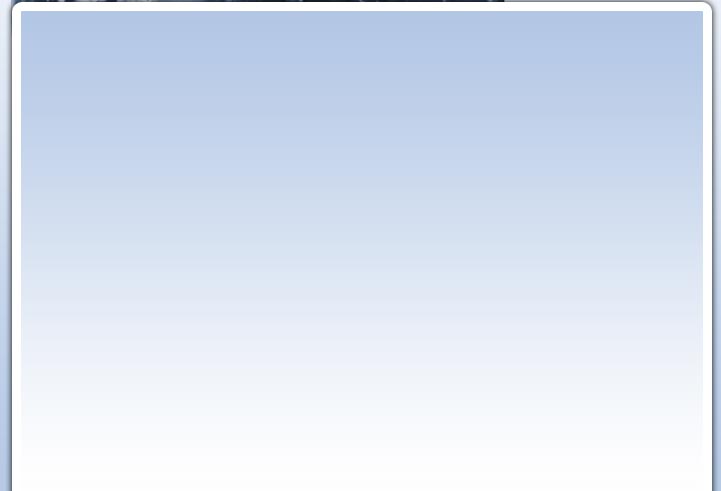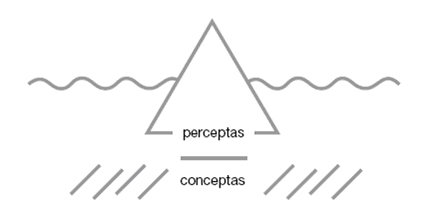Eigenes
"Eine Kultur bzw. Lebenswelt wird dann als ›eigene‹ und ›nichtfremde‹
bezeichnet, wenn die Kontextbedingungen ein alltagsbezogenes Routinehandeln
ermöglichen, das für den Handelnden durch Plausibilität bzw.
Normalität und Sinnhaftigkeit charakterisiert ist" (
Wille
2003;
Internetquelle).
Das Eigene entsteht und existiert immer nur im bzw. als Vergleich und Kontrast
zum Fremden (
Rösch
2004). Nur im Verhältnis zwischen Autostereotyp (Selbstbild) und Heterostereotyp
(Fremdbild) wird es deshalb erschließbar.
 zum
Seitenanfang
Eisbergmodell
zum
Seitenanfang
Eisbergmodell
Das in der Kulturwissenschaft gerne verwendete Modell verdeutlicht, dass immer
nur ein kleiner Teil kultureller Spezifik sichtbar oder wahrnehmbar ist. Das
Wahrnehmbare selbst (perceptas) ist wiederum "Zeichen" für zugrunde
liegende (aber als solche nicht sichtbare) Denk- und Handlungskonzepte (conceptas).
Das Eisbergmodell; Quelle: IKO
2004; Internetquelle
 zum
Seitenanfang
Emisch vs. Etisch
zum
Seitenanfang
Emisch vs. Etisch
Emisch ist die Innensicht bzw. Binnenperspektive von Mitgliedern einer Kultur,
während "etisch" die distanzierte Außensicht bezeichnet.
Emisches Forschungsvorgehen versucht, universelle und eigenkulturelle Kriterien
bzw. Erfassungskategorien auszublenden, um die fremde Kultur ›von innen‹
her zu verstehen und zu beschreiben. Dieser Anspruch besteht insbesondere bei
der teilnehmenden stationären ethnologischen Feldforschung. Der etische
Forschungsansatz sucht universell gültige Kategorien. Er eignet sich insbesondere
für kulturvergleichende Studien.
 Cross-Cultural
Studies
Cross-Cultural
Studies
 zum
Seitenanfang
Empathie
zum
Seitenanfang
Empathie
"Als Empathie (griech. = Mitfühlen) bezeichnet man die Fähigkeit
und vor allem die Bereitschaft eines Menschen, sich in andere hineinzuversetzen
und sich über ihr Handeln, Verstehen und Fühlen klar zu werden. Wesentlich
dabei ist, dass der eigene Affektzustand dem Gefühlszustand einer anderen
Person entspricht. Dies wird dadurch ausgelöst, dass man die Perspektive
der anderen Person einnimmt und ihre Gefühle versteht. Beispielsweise in
Anti-Aggressions-Therapien wird die Fähigkeit von (potenziellen) Gewalttätern
gefördert, sich empathisch in ihre Opfer hineinzuversetzen" (
Wikipedia
2004: Empathie;
Internetquelle).
Empathie bezeichnet das Einfühlungsvermögen in Bezug auf die Befindlichkeiten
und Denkweisen anderer, ohne dass damit zwangsläufig eine (vollständige)
Akzeptanz der Positionen der anderen einhergeht. Im engeren Sinne ist Empathie
das unfreiwillige Empfinden der Emotionen eines anderen.
 zum
Seitenanfang
Empowerment
zum
Seitenanfang
Empowerment
Wörtlich aus dem Englischen übersetzt heißt Empowerment Bevollmächtigung
oder Ermächtigung. Im wirtschaftlichen Bereich meint der Begriff die Übertragung
von Verantwortung auf Untergebene. "Mit Empowerment bezeichnet man Strategien
und Maßnahmen, die geeignet sind, das Maß an Selbstbestimmung und
Autonomie im Leben der Menschen zu erhöhen und sie in die Lage zu versetzen,
ihre Belange (wieder) eigenmächtig, selbstverantwortet und selbstbestimmt
zu vertreten und zu gestalten. Empowerment bezeichnet dabei sowohl den Prozess
der Selbstbemächtigung als auch die professionelle Unterstützung der
Menschen, ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahrzunehmen und zu
nutzen. Im Deutschen wird Empowerment gelegentlich auch als Selbstkompetenz
bezeichnet" (
Wikipedia
2004: Empowerment;
Internetquelle).
Der GTZ zufolge wird in der Entwicklungszusammenarbeit unter Empowerment ein
fortdauernder Prozess verstanden, der bei benachteiligten Bevölkerungsgruppen
das Selbstvertrauen stärkt, sie zur Artikulation ihrer Interessen und zur
Beteiligung in der Gemeinschaft befähigt und ihnen den Zugang zu und die
Kontrolle von Ressourcen verschafft, damit sie ihr Leben selbstbestimmt und
eigenverantwortlich gestalten und sich am politischen Prozess beteiligen können.
Insofern nimmt die Veränderung von sozialen, ökonomischen, rechtlichen
und politischen Institutionen, welche die gegenwärtigen Machtverhältnisse
verkörpern, eine zentrale Stellung ein. So zielt z. B. der Empowerment-Ansatz
in der Frauenförderung auf Selbstbestimmung, Erweiterung der Selbstorganisation
und eine aktivere Rolle von Frauen in allen gesellschaftlichen Prozessen ab
(vgl.:
GTZ 2004b;
Internetquelle).
Die DEZA betont die politische Dimension des Engagements für die Benachteiligten
und ihr Empowerment. Dadurch werden Entwicklungsmodelle, Interessen und Machtverhältnisse
in Frage gestellt: "Wenn wir uns zusammen mit den Armen für eine Veränderung
dieser Verhältnisse engagieren, so nehmen wir unvermeidlich Konflikte in
Kauf, latente Konflikte werden sichtbar oder brechen auf. Die Armutsgrundsätze
verpflichten uns, Spielräume, Mechanismen und Fähigkeiten für
friedliche Lösungen von Konflikten zu unterstützen" (
DEZA 2004).
Das UN-Entwicklungsprogramm hat mit dem Index "Gender Empowerment Masure"/GEM
einen geschlechtsbezogenen Empowerment-Index eingeführt. GEM misst die
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern bei ökonomischen und politischen
Wahlmöglichkeiten (vgl.
Holtz
2006).
 zum
Seitenanfang
Enkulturation
zum
Seitenanfang
Enkulturation
Der auf den Ethnologen Herskovits zurückgehende Begriff bezeichnet das
informelle Lernen, Beobachten und Nachahmen kultureller Verhaltensweisen beim
Hineinwachsen in eine soziokulturelle Umgebung. In Erweiterung zum Sozialisationsbegriff
betont Enkulturation die kulturspezifische Dimension von Wissenserwerb, wie
auch kulturspezifische Methoden der Umsetzung von Wissen. Das Individuum lernt
dabei die Möglichkeiten der persönlichen Entfaltung (Identität,
Orientierungswissen) ebenso kennen wie das Respektieren der kulturellen Rahmenbedingungen.
Enkulturation ist stets auf die Primärsozialisation bezogen, während
 Akkomodation
Akkomodation
und
 Akkulturation
Akkulturation
hierauf aufbauen und von daher der Sekundärsozialisation zugerechnet werden
(vgl.
IKO 2004;
Internetquelle).
 zum
Seitenanfang
Entwicklung
zum
Seitenanfang
Entwicklung
Biologisch verwendet meint Entwicklung den Lebenszyklus von Pflanzen und Tieren.
Erst seit dem 17. Jh. wird der Begriff, der mit dem lateinischen explicare und
dem französischen évoluer in Verbindung steht, i. S. von ›Gedanken
entwickeln, sich herausbilden‹ verwendet. Seit dem ausgehenden 19. Jh.
findet er Verwendung als Metapher für Vorgänge in Wirtschaft, Gesellschaft
und Psychologie. Im modernen Sinne meint er seit dem 20. Jh. einen linearen
Prozess ›menschlichen Fortschritts‹. Beim transitiven Entwicklungsbegriff
geht es darum, etwas anderes zum Gegenstand eigener Entwicklungsbemühungen
zu machen.
Wie der Kulturbegriff, ist der Entwicklungsbegriff historisch und politisch
so stark und gleichzeitig gegensätzlich besetzt, dass eine einheitliche
Definition kaum möglich scheint. Holtz (
2006)
definiert Entwicklung als einen mehrdimensionalen, komplexen Prozess, "der
auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse und die Sicherung eines menschenwürdigen
Lebens in Freiheit von Not und Furcht für alle, auf Frieden sowie die Zukunftsfähigkeit
von Gesellschaften und der Einen Welt abzielt". Mit ähnlichem Tenor
meint die Südkommission - ein Zusammenschluss von Nicht-OECD-Ländern
1990: "Entwicklung ist ein Prozess, der es den Menschen ermöglicht,
ihre Fähigkeiten zu entfalten, Selbstvertrauen zu gewinnen und ein erfülltes
und menschenwürdiges Leben zu führen".
Mit ganz anderem Tenor findet nach Toynbee Entwicklung dort statt, wo auf eine
Herausforderung eine Antwort erfolgt ("challenge and response"). Nach
dieser Diktion bräuchte Entwicklung also einen externen Stimulus. ›Autodéveloppement‹
gäbe es danach nicht (vgl.
Thiel
2003). Eine beißende Kritik an dem mit Präsident Trumans Amtsantrittsrede
von 1949 "als westliche Dominanzmetapher umgeformten Entwicklungsbegriff"
und ein Plädoyer für dessen analytische Dekonstruktion liefert z.
B. Gustavo Esteva (
1993).
Bierschenk behandelt den Begriff ›Entwicklung‹ in drei Dimensionen:
als analytische Kategorie, als Forschungsgegenstand und als politische Praxis.
Letztere ist gekoppelt "an eine Ideologie bzw. einen moralischen Diskurs
über die Wünschbarkeit von gesellschaftlichen Zuständen"
(
Bierschenk
2003b).
Entwicklung kann nach Bierschenk untersucht werden:
- als langfristiger historischer Prozess (struktureller, i. e. organisatorischer,
sozioökonomischer, kultureller ›Umbau‹ der Gesellschaft,
Frage nach dem sozialen Wandel und seinen Quellen)
- als politisches und wirtschaftliches Projekt ("Zeitalter der Entwicklung"
seit ca. 1945. Kontext: Entkolonialisierung, Kalter Krieg; Kernvorstellungen:
Staat als Modernisierungsagent/ geplanter bzw. induzierter sozialer Wandel):
- als soziale Situation (direkte und indirekte Interaktionen zwischen sozialen
Akteuren und Gruppen in einem Kontext geplanter Entwicklung) oder als Entwicklungshilfeprojekt
(vgl. Bierschenk
2003b).
Entwicklung findet auch konträr zu den Intentionen der Entwicklungshilfegeber
statt. Manches, was als Entwicklungsbremse dargestellt wird, ist eher als Ausdruck
von nicht wahrgenommenen endogenen Entwicklungsvorstellungen zu sehen. Deshalb
definiert die Arbeitsgemeinschaft Entwicklungsethnologie Entwicklung z. B. "als
die Verbesserung der Situation von Menschen gemäß ihrer eigenen Kriterien
und Ziele vor dem Hintergrund einer gemeinsamen globalen Verantwortung"
(
 AGEE
AGEE;
Internetquelle).
Die Finnische EZ-Agentur verweist auch auf die negative Reichweite von Entwicklung:
Jeder Akt von Entwicklung ist danach auch ein Akt der Zerstörung. Jeder
Wechsel greift in die Physiologie, Psychologie und in das Verhalten der Bevölkerung
ein (vgl. Finnida 2004).
Die
 UNESCO
UNESCO
verbindet 2001 den Entwicklungsbegriff mit dem der
 kulturellen
Vielfalt
kulturellen
Vielfalt: "Kulturelle Vielfalt erweitert die Freiheitsspielräume
jedes Einzelnen; sie ist eine der Wurzeln von Entwicklung, wobei diese nicht
allein im Sinne des wirtschaftlichen Wachstums gefasst werden darf, sondern
als Weg zu einer erfüllteren intellektuellen, emotionalen, moralischen
und geistigen Existenz" (
UNESCO
2001, Art. 3 der Dekl. zur kulturellen Vielfalt:
Internetquelle).
Der neueste UNDP Human Development Report 2004 verbindet ebenfalls Entwicklung
mit kulturellen Kriterien.
 zum
Seitenanfang
Entwicklung, autozentrierte
zum
Seitenanfang
Entwicklung, autozentrierte
Nach Schubert und Klein bezeichnet autozentrierte Entwicklung die "Entwicklungsstrategie,
die den Ländern der Dritten Welt empfiehlt, sich strikt an den Produktionsmöglichkeiten
und Nachfragepotentialen des Binnenmarktes zu orientieren, sich insofern dem
Druck des Weltmarktes zu entziehen und somit wirtschaftliches Wachstum durch
Aufbau und Entfaltung der eigenen Ressourcen und Möglichkeiten zu ermöglichen"
(
Schubert/Klein
2001). Das Konzept ist eng mit dem Zentrum/Peripheriemodell der
 Dependenztheorie
Dependenztheorie
verknüpft (vgl.
Amin
1974). Es wurde wie die Dependenztheorie wegen seiner ausschließlichen
Betonung der externen entwicklungshemmenden Faktoren kritisiert und in der Folge
modifiziert und relativiert (vgl.
Senghaas
1982 und
Menzel
1988).
Hein (
2001
in E+Z) plädiert dafür, den Begriff von der ausschließlichen
ökonomischen Konnotation zu befreien, so dass er "im Allgemeinen einen
strukturell bedingt selbstreferentiellen Entwicklungsprozess einer Gesellschaft
bezeichnet" und somit Antworten auf die Frage nach den spezifischen lokalen
Entwicklungspotentialen und -problemen im Rahmen einer
 ›Good
Governance‹
›Good
Governance‹-Strategie gibt. Der Ansatz der autozentrierten Entwicklung
wurde vor allem von Autoren/innen aus der Dritten Welt vertreten.
 Endogene
entwicklungshemmende Faktoren
Endogene
entwicklungshemmende Faktoren;
 Entwicklung
Entwicklung
 zum
Seitenanfang
Entwicklung, soziale
zum
Seitenanfang
Entwicklung, soziale
Die Weltbank-Arbeitsdefinition für Social Development bezieht sich auf
die Relationen und institutionellen Bedingungen in einer Gesellschaft und auf
die historischen, politischen und institutionellen Bedingungen, die Projekt-
und Politikergebnisse beeinflussen. Ziel des Social Development ist es, das
 Empowerment
Empowerment
armer Menschen zu stärken, indem man ihre Fähigkeiten und sie mit
einschließende Institutionen (inclusive institutions) fördert.
Es geht um Partizipation und Bürgerengagement, um
 social
analysis
social
analysis, Konfliktprävention und Wiederaufbau, von Gemeinschaften
selbst angetriebene Entwicklung und soziale Sicherheit. Sozial verantwortliche
Entwicklung muss verschiedene Ebenen (regional, national, lokal) und deren Einflüsse
auf die Vorhaben beachten. So muss z. B. analysiert werden, wie arme Menschen
einen fairen Zugang zum Markt erhalten. Seit Frühjahr 2004 gibt es dazu
ein Strategiepapier (
World Bank 2004).
 zum
Seitenanfang
Entwicklungsethnologie
zum
Seitenanfang
Entwicklungsethnologie
Dieser Bereich der Ethnologie beschäftigt sich mit modernen, weltweiten
sozialen und kulturellen Wandlungsprozessen; in Deutschland wird er vor allem
durch die Arbeit der
 AGEE
AGEE
(z. B. Bliss, Antweiler, Schönhuth) vorangetrieben, die seit 1986 einen
kontinuierlichen Dialog mit der Entwicklungspraxis etabliert hat. Zur Frage
der praktischen Involvierung von EntwicklungsethnologInnen in die Arbeit von
EZ-Organisationen (vgl.
Dettmar
1999) hat die Arbeitsgemeinschaft Entwicklungsethnologie ethische Richtlinien
formuliert.
Im Gegensatz dazu liegt der Fokus einer "Ethnologie der Entwicklung"
auf der Untersuchung der Strukturen, in denen Entwicklung stattfindet, und der
Institutionen und Akteure, die dabei eine Rolle spielen. In Deutschland vor
allem erforscht durch Schüler des Bielefelder Entwicklungssoziologen Hans-Dieter
Evers (Bielefelder Verflechtungsansatz und strategischer Gruppenansatz; dazu
Bierschenk
2002) und die "Berliner Schule" um Elwert und Weiß (vgl.
Hüsken
2004).
 zum
Seitenanfang
Entwicklungsethnologie und Kultur
zum
Seitenanfang
Entwicklungsethnologie und Kultur
Einen wichtigen Beitrag zur Renaissance der soziokulturellen Dimension hat die
deutsche Entwicklungsethnologie geleistet. Ihr Engagement hat dazu beigetragen,
dass die Einbeziehung soziokultureller Faktoren und Partizipation bei der Planung,
Implementierung und Evaluierung von EZ-Projekten heute zum entwicklungspolitischen
Standard gehört. Exemplarisch für dieses Engagement ist die Erweiterung
der Simsonschen soziokulturellen Schlüsselfaktoren durch Bliss, Gaesing
und Neumann (
1997),
aber auch die Beiträge von Schönhuth und Kievelitz (
1993)
zur Differenzierung der Appraisal-Verfahren in der GTZ und die Überlegungen
zur interkulturellen Problematik der "Zielorientierten Projektplanung"
(ZOPP) von Kievelitz und Tilmes (
1992).
Im Gegensatz zu anderen Expertengruppen der EZ bezieht die Entwicklungsethnologie
eine explizit politisch verstandene Position. Hierzu gehört sowohl die
Selbstverortung als Anwaltschaft für die Zielgruppen der EZ, als auch die
Formulierung einer moralisch-ethischen Agenda für die gesamte entwicklungspolitische
Praxis. Bliss und Schönhuth haben dazu acht "Ethische Leitlinien für
die entwicklungspolitische Praxis" (re)formuliert. Sie verstehen ihren
Regelkanon als Orientierungshilfe und Handlungsanweisung für Gutachter
und Projektexperten zur Lösung von Loyalitätskonflikten, die sich
aus dem Spannungsfeld der Interessen von Auftraggebern, Zielgruppen und der
internationalen Öffentlichkeit ergeben (
Bliss/Schönhuth
2002: 4). Die Zeitschrift Entwicklungsethnologie der
 AGEE
AGEE
dokumentiert seit 15 Jahren die Arbeit von EntwicklungsethnologInnen. (
www.entwicklungsethnologie.de).
 zum
Seitenanfang
Entwicklungsethnologie
und partizipative EZ
zum
Seitenanfang
Entwicklungsethnologie
und partizipative EZ
Die partizipative EZ in Deutschland wurde unter anderem durch Arbeiten von Entwicklungsethnologen
wesentlich beeinflusst. So wurde das Handbuch zu partizipativen Methoden in
der EZ von zwei Ethnologen verfasst (
Schönhuth/Kievelitz
1993). Am Zielgruppenansatz der TZ und dessen Einbindung in die Strategien
der FZ waren Ethnologen ebenfalls maßgeblich beteiligt (
Bliss/König
2003). Auch die kulturellen Grenzen partizipativer Ansätze wurden von
ihnen bearbeitet (
Hess
et al. 1998).
 zum
Seitenanfang
Entwicklungsfaktoren, endogene
zum
Seitenanfang
Entwicklungsfaktoren, endogene
Axelle Kabou beschäftigt sich in ihrer Streitschrift gegen ›schwarze
Eliten und weiße Helfer‹ (
1993)
mit den endogenen Faktoren der afrikanischen Entwicklungsproblematik. Mit Blick
auf die erfolgreichen Asiaten mahnt die Autorin an, dass Afrika sich für
seine Geschichte selbst verantwortlich fühlen und sein Schicksal in die
eigenen Hände nehmen solle. Sie grenzt sich damit von der Mehrheit afrikanischer
Politiker und Intellektueller ab, die im Weltwirtschaftssystem und im (Post-)Kolonialismus
die Schuld an den Problemen sehen (
 Dependenztheorie
Dependenztheorie).
Wegen ihres letztlich wieder modernisierungstheoretischen Lösungsansatzes
und der These der ›kulturfreien‹ Übertragbarkeit asiatischer
Modelle (so z. B. eine Kritik von
Menzel
1994: 51) wurde Kabous Ansatz nicht nur von afrikanischen Linksintellektuellen
heftig kritisiert.
 Autozentrierte
Entwicklung
Autozentrierte
Entwicklung
 zum
Seitenanfang
Entwicklungspartnerschaft
zum
Seitenanfang
Entwicklungspartnerschaft
In der Definition des BMZ: "Eine Entwicklungspartnerschaft ist eine langfristig
ausgerichtete Zusammenarbeit mit gleichberechtigten Partnern (
BMZ
2001b: 68), in der, wie das Wort ›gleichberechtigt‹ schon suggeriert,
der Partizipation eine wichtige Rolle zukommt."
Wie auch beim
 Dialog
auf Augenhöhe
Dialog
auf Augenhöhe lässt sich der Begriff der Entwicklungspartnerschaft
auch dazu benutzen, das vorhandene Machtgefälle in der Entwicklungszusammenarbeit
euphemistisch zu verschleiern. Er steht in auffälligem Widerspruch zur
 Konditionalisierung
Konditionalisierung,
d. h. der Bindung von Entwicklungshilfe an vom Westen definierte entwicklungsfreundliche
Bedingungen.
 Macht
Macht;
 Interkultureller
Dialog
Interkultureller
Dialog;
 Partizipation
in der EZ
Partizipation
in der EZ
 zum
Seitenanfang
Entwicklungstheorien
zum
Seitenanfang
Entwicklungstheorien
In den klassischen Entwicklungsansätzen spielt die kulturelle Dimension
von Entwicklung keine Rolle. Dependenztheoretiker hindert der ›sozialistische
Fernblick‹ (
Faschingeder
et. al. 2003), in Kultur und Tradition mehr zu sehen als nur ein Entwicklungshemmnis
hin zur klassenlosen Gesellschaft. (vgl. auch
 Clash
of Cultures
Clash
of Cultures; kulturalistische
 Modernisierungstheorie
Modernisierungstheorie:
gleiches Argument!) Die Grundbedürfnisstrategie der 1970er Jahre plante
vor allem für Betroffene, blieb letztlich den westlichen Handlungsrationalitäten
verhaftet und damit ebenfalls kulturblind. Selbst die Vertreter einer autozentrierten
Entwicklung des Südens thematisieren Kultur in erster Linie als Herrschaftsinstrument
oder Kampfarena, in der Schlachten um die Konstruktion von Identitäten
ausgetragen werden.
Auch nach Auflösung der Lagergrenzen blieben etliche Autoren dem eurozentrischen
Weltbild verhaftet (
Senghaas
1982: "Von Europa lernen"). Heute ist breiter Konsens in der angewandten
internationalen Forschung und entwicklungspolitischen Diskussion, dass Kultur
im Entwicklungsprozess eine Rolle spielt, und dass entwicklungspolitische Maßnahmen
dann am besten funktionieren, wenn sie auf der Basis des Alltagswissens (
 lokales
Wissen
lokales
Wissen) von Zielgruppen aufbauen.
Die von Huntington und anderen vertretene Modernisierungsthese, nach der bestimmte
essentiell vorgestellte Kulturen die menschliche Entwicklung hemmen, und andere
die menschliche Entwicklung fördern (
 ›Kultur
als Entwicklungshemmnis‹
›Kultur
als Entwicklungshemmnis‹), wird vom Mainstream der internationalen
Forschung als ebenso einseitig kritisiert, wie Arturo Escobars poststrukturalistische
Entwicklungskritik, die
 "Kultur
als ein System ideologischer Kontrolle"
"Kultur
als ein System ideologischer Kontrolle"; versteht, mit dessen Hilfe
die seit der Kolonialzeit bestehenden Ungleichheiten zwischen reichen und armen
Ländern aufrechterhalten und zementiert werden.
Für die Vertreter einer Richtung, die die homogenisierende Wirkung der
Globalisierung uneingeschränkt befürworten, dient das Kulturargument
häufig der Maskierung ökonomischer Ineffizienz (
 Kultur
als Restkategorie
Kultur
als Restkategorie).
Nach der Glokalisierungsperspektive (Robertson;
 Glokalisierung
Glokalisierung),
die von der Mehrzahl der Autoren heute favorisiert wird, erfolgt Globalisierung
nicht durch die Hand eines anonymen Marktes oder einer primordialen Prägung,
sondern im Zusammenspiel unterschiedlich machthaltiger Strategien (
Wimmer
1997). Globalisierung findet dann erfolgreich statt, wenn dies aus der Interessensperspektive
lokaler Akteure Sinn macht, und wenn die globalen Muster in bereits etablierte
politisch-kulturelle Muster einzufügen und umzudeuten sind.
Diese Perspektive geht von aktiv und strategisch handelnden Akteuren im Entwicklungsprozess
aus, deren Partizipations- und Handlungschancen durch politische, sozioökonomische
und soziokulturelle Rahmenbedingungen zwar mitbestimmt, aber nicht präformiert
sind. Sie rechnet mit Kultur, liefert aber die Akteure ihren ›kulturellen
Prägungen‹ nicht aus (
 Kultur
als Fluxus
Kultur
als Fluxus).
 zum
Seitenanfang
Entwicklungszusammenarbeit
zum
Seitenanfang
Entwicklungszusammenarbeit
Während Kultur früher eher als Hindernis für die Entwicklung
verstanden wurde, hat sich dieses Verständnis grundlegend gewandelt im
Sinne von Kultur als Mittel für Entwicklung bis hin zu Kultur als Chance
und Selbstzweck.
Deutlich wird diese positive Verbindung von Kultur und Entwicklung z. B. im
 Partizipationskonzept
Partizipationskonzept
des BMZ von 1999. Auch das jüngste Evaluierungsraster für Gutachter
(
BMZ 2002)
spricht diesen Zusammenhang an und bezieht sich dabei unter anderem auf eine
Ex-Post-Evaluierung von 32 abgeschlossenen Projekten der deutschen Staatlichen
Zusammenarbeit (
BMZ
2000), die einen signifikanten Zusammenhang zwischen Zielerreichung und
Kulturangepasstheit aufzeigte. Neben der kontinuierlichen finanziellen Leistungsfähigkeit
des Projektträgers sind es ein partizipativ hergestellter Zielkonsens (
 Dialog
auf Augenhöhe
Dialog
auf Augenhöhe) und die Kulturangepasstheit, die maßgeblich
nachhaltigen Erfolg oder Misserfolg von Projekten und Programmen bestimmen.
Deshalb müsse den soziokulturellen Rahmenbedingungen der gleiche Stellenwert
zukommen, wie ökonomischen und naturwissenschaftlichen.
Während diese empirischen Ergebnisse eindeutig für die Beachtung der
 Kultur
Kultur
als Rahmenbedingung für jegliche EZ sprechen, zeigt eine andere Erkenntnis
aus der Evaluierung die Grenzen einer kulturellen Strategie auf: Die
 Akzeptanz
Akzeptanz
der Durchführungsträger der FZ lag zu allen Untersuchungszeitpunkten
deutlich höher als die der TZ-Projekte. Investitionsmaßnahmen liegen
demnach offensichtlich weit eher im (wirtschaftlichen) Interesse der Partner
als Vorhaben, die auf Veränderungen von Menschen und Organisationen ausgerichtet
sind (
BMZ 2000:
8).
Hält die Partnerseite vorwiegend einen Transfer von Technologie und Geldmitteln
für notwendig, um Entwicklung anzukurbeln, so ist die deutsche Seite manchmal
vorrangig an Strukturveränderungen und der Ausbildung von Managementfähigkeiten
("Können") bei den Partnern (Mittler und Zielgruppen) interessiert,
wenn es um nachhaltige Entwicklung geht. Die Ausbildung von Strukturen und Befähigungen
(capacities, capabilities, skills) hat neben politischen, wirtschaftlichen und
umweltbezogenen Voraussetzungen immer auch eine soziokulturelle Dimension, die
diese Strukturen und Befähigungen gesellschaftlich legitimiert und begründet,
und ihnen Sinn und Konstanz verleihen. Damit wird jegliche Entwicklungsintervention
auch zu einer kulturellen Intervention.
Zur Positionierung der GTZ bzgl. Kultur und Entwicklung, in der dem metaphorischen
Begriff der
 kulturellen
Bühne
kulturellen
Bühne als funktionaler Handlungsrahmen von EZ eine wichtige Rolle
zukommt.
 zum
Seitenanfang
Erlebniskultur
zum
Seitenanfang
Erlebniskultur
Erlebniskultur ist ein zentrales Merkmal der Konsumkultur, die sich nach dem
Zweiten Weltkrieg in den westlichen Industriegesellschaften entwickelt hat.
Sie stellt die Möglichkeit dar, Waren zu nutzen, um Erlebnisse und Erfahrungen
zu machen. Der Wunsch, viele und intensive Erlebnisse zu haben, führt zu
einer Steigerung der gesellschaftlichen Individualisierung (›Erlebnisgesellschaft‹);
vgl.
Hügel
2003; Hg.: 32 f. Insofern ist Erlebniskultur eng mit dem Begriff der
 Populärkultur
Populärkultur
verknüpft, in der Unterhaltung ein zentrales Element darstellt.
 zum
Seitenanfang
Essentialisierung
zum
Seitenanfang
Essentialisierung
Essentialisierung ist die Festschreibung des anderen auf seine Andersartigkeit
bzw. des Eigenen auf seine ursprüngliche Wesenheit (Essenz), wobei innere
Differenzen nivelliert werden. "Essentialismus beschreibt die Annahme,
dass Gegenstände - unabhängig von Kontext und Interpretation - eine
ihnen zu Grunde liegende, alle Veränderungen überdauernde Essenz aufweisen,
die ihre ›wahre Natur‹ bestimmt und sie notwendig zu dem macht, was
sie sind." (
Babka/Posselt
2003;
Internetquelle).
Die Folgen der Essentialisierung von Kultur zeigen sich zum Beispiel in:
- einer globalen Tourismusindustrie, die das authentische und exotische
"Andere" für ökonomische Zwecke einsetzt. ("Kommerzialisierung");
- nationalistischen Dritt-Welt-Diskursen, die Geschichte singularisieren
und "Tradition" als Gegenentwurf zur wahrgenommenen "Verwestlichung"
oder "Neokolonialisierung" zu etablieren suchen (
 "Kulturalisierung")
"Kulturalisierung")
- meist von außen herangetragenen, romantizierenden Entwürfen
"traditioneller", speziell "Stammes"-Gesellschaften,
die eine "verschwindende Welt" gegen den Einfluss des Modernismus
schützen will ("Naturalisierung, Exotisierung")
 Selbst-
und Fremdethnisierungstendenzen.
Selbst-
und Fremdethnisierungstendenzen.
 zum
Seitenanfang
Essentialismus, kultureller
zum
Seitenanfang
Essentialismus, kultureller
In den 1970er Jahren begannen zahlreiche Gruppen (von Minderheiten bis Nationen)
die Kategorien Kultur und Ethnos für sich offensiv zu übernehmen und
im Rahmen ihrer kulturellen Besonderheiten Rechte zu erkämpfen und sich
gegen konkurrierende Interessen durchzusetzen. Es ist eine Vielzahl neuer kultureller
Identitäten entstanden oder geschaffen worden, und hat sich in Form eines
offiziellen Multikulturalismus das öffentliche Bewusstsein erobert (
Breidenbach/Nyíri
2004: 24).
 Kulturalismus
Kulturalismus;
 Essentialismus,
strategischer
Essentialismus,
strategischer
 zum
Seitenanfang
Essentialismus, strategischer
zum
Seitenanfang
Essentialismus, strategischer
Der Ambivalenz einer
 Identitätspolitik
Identitätspolitik
von Gruppen, die sich über deren Konstruktionscharakter bewusst sind, sie
aber für die Durchsetzung ihrer Interessen für unverzichtbar halten,
stellt Gayatri Chakravorty Spivak 1985 den Entwurf des strategischen Essentialismus
entgegen. Dieser stellt ein politisch motiviertes, mit der Einsicht in den Konstruktionscharakter
kultureller Eigenarten verbundenes und daher reflektiertes Beharren auf gruppenspezifischen,
essentiellen Wesenszügen und Authentizität dar (vgl.
Stölting
2001;
Internetquelle).
Dieter Senghaas (
1998:
38-44) spricht in diesem Zusammenhang von der Haltung einer angestrebten "halbierten
Modernisierung", die einerseits grundlegenden gesellschaftlichen Wandel
will, andererseits jedoch bestimmte, einer Gruppe eigene Wesenszüge unbedingt
zu erhalten wünscht. Strategischer Essentialismus ist eine Reaktion auf
steigende gesellschaftliche Reflexivität (
Giddens
1995) auf der einen Seite und steigenden Orientierungsbedarf in einer durch
Komplexität und Kontingenz geprägten gesellschaftlichen Situation
auf der anderen.
Umstritten ist die Frage, ob strategischer Essentialismus ein Modell für
Identitätspolitiken in einer durch fortschreitende Enttraditionalisierung
und globale Interdependenz geprägten Welt darstellt. (Vgl.
Stölting
2001;
Internetquelle).
 Kulturalismus
Kulturalismus;
 Identitätspolitik
Identitätspolitik
 zum
Seitenanfang
Ethik
zum
Seitenanfang
Ethik
Ethik bezeichnet allgemein die Lehre oder Wissenschaft vom Sittlichen, jenen
Teil der Philosophie, der das moralische Bewusstsein und Verhalten der Menschen
zum Gegenstand hat (vgl.
Buhr
und Klaus 1971: 328).
"Der Name ›Ethik‹ ist vom griechischen Wort ethos abgeleitet.
Dieses selbst weist mehrere voneinander unterschiedene Bedeutungen auf. Es bedeutet
erstens, meist im Plural gebraucht, den gewohnten Aufenthaltsort, den Wohnsitz,
die Wohnung, auch Heimat; zweitens, ebenfalls meist im Plural, die Gewohnheiten,
das Herkommen, die gewohnte Art des Menschen, sich zu verhalten, die Lebensgewohnheiten,
Sitten, Bräuche usw.; drittens das sittliche Bewusstsein, die sittliche
Gesinnung und Haltung, den sittlichen Charakter, das Sittliche, die Sittlichkeit."
Die unterschiedlichen Bedeutungen des Wortes spiegeln "unterschiedliche
Entwicklungsetappen in der Geschichte (besonders Frühgeschichte) der menschlichen
Gesellschaft" (
Buhr
und Klaus, 1971: 328): Erst steht der Begriff im materiellen Kontext, dann
umfasst er das Verhalten, allerdings noch eng verbunden mit Verhältnissen
des Zusammenlebens, heute wird er umfassend interpretiert.
Nach Kant ist ethisches Bewusstsein und Verhalten jedem Menschen unabhängig
von seiner Herkunft über den Zugang der allgemeinen Vernunft möglich.
Seine deontologische Ethik beruft sich auf Pflicht, auf die Motivation zur Handlung,
während die utilitaristische Ethik eher das Ergebnis einer Handlung betrachtet.
 zum
Seitenanfang
Ethik in der Entwicklungsforschung
zum
Seitenanfang
Ethik in der Entwicklungsforschung
Kulturorientierte Entwicklungsforschung ist bis heute mehrheitlich ein Forschen
über und nicht für, mit oder gar durch Menschengruppen. Es wird nach
unten, also auf lokaler Ebene geforscht ("small places, large issues",
Eriksen 2001).
Das dabei gewonnene Wissen wird aber in erster Linie nach oben, dem wissenschaftlich
westlich orientierten Wissensordnungsapparat (
Hobart
1993) zur Verfügung gestellt, nicht den Betroffenen. Ethikfragen der
Forschung werden in den meisten gängigen Lehrbüchern (vgl. dazu
Antweiler
2002: 30), aber auch in Methodenhandbüchern kaum thematisiert. Anwendungsorientierte
Lehr- und Methodenbücher geben dem Thema mehr Raum, so z. B.
Ervin
2000 (Kap. 3),
Mikkelsen
1995 oder, im deutschen Sprachraum,
Girtler
2001, Kap.4).
 AGEE
AGEE;
 Ethik
in der Entwicklungszusammenarbeit
Ethik
in der Entwicklungszusammenarbeit
 zum
Seitenanfang
Ethik in der EZ
zum
Seitenanfang
Ethik in der EZ
Entwicklungszusammenarbeit findet im Spannungsfeld unterschiedlicher Wertesysteme
und Interessen und vor dem Hintergrund eines strukturellen Machtgefälles
zwischen Nord und Süd (›Geber/Nehmer‹) statt. Ethische Dilemmata
sind dabei für ausländische Fachkräfte unausweichlich. Sie sind
ihrem Auftraggeber verpflichtet, aber sie sind es auch gegenüber der Zielgruppe
und in vielen Fällen gegenüber der internationalen Öffentlichkeit.
Das Dilemma lässt sich meist nur durch eine Güterabwägung lösen,
aber es gab bisher in Deutschland keine berufsethischen Maßstäbe
dafür.
Die Arbeitsgemeinschaft Entwicklungsethnologie (
 AGEE
AGEE)
hat "Ethische Leitlinien" entworfen, die Antworten z. B. auf folgende
Fragen geben wollen: Wie lassen sich Entwicklungsziele und Interessen des Auftraggebers
mit den möglicherweise erheblich davon abweichenden Vorstellungen der Zielgruppen
vereinbaren? Wie weit kann der Partizipationsanspruch in einem kulturell scheinbar
partizipationsfeindlichen Umfeld gehen? Welche Grenzen haben Schweigepflichtklauseln
in Gutachterverträgen? Wie lassen sich Informantenschutz und Nachprüfbarkeit
der Untersuchungsaussagen miteinander vereinbaren? 2002 gab es dazu auch eine
Tagung mit reger Beteiligung aus den entwicklungspolitischen Institutionen (vgl.
Bliss/Schönhuth/Zucker
2002. Vgl. auch:
Bliss/Schönhuth 2002
1;
Internetquelle
2).
 AGEE
AGEE;
 Weltethos
Weltethos
 zum
Seitenanfang
Ethnie / ethnische Gruppe
zum
Seitenanfang
Ethnie / ethnische Gruppe
Früher wurde eine Ethnie bestimmt als eine Gruppe, die biologisch ihren
Bestand weitgehend unabhängig aufrechterhält, über charakteristische
Kulturwerte verfügt, ein fest gefügtes Netz von Kommunikation besitzt
und sich von anderen solchen Gruppen unterscheidet (nach
Barth,
1969). Heute versteht man darunter überfamiliäre und gleichzeitig
familienumfassende (also Verwandtschaft organisierende) Lebensgemeinschaften,
also Wir-Gruppen oberhalb der realen oder fiktiven Verwandtschaft (Lineage,
Klan, Stamm) und unterhalb der Nation, die ein eigenes Selbstverständnis
und selbst- sowie fremdzugeschriebene Traditionen aufweisen. Erst die Übereinstimmung
von Selbst- und Fremdzuschreibung macht sie stabil. Die gesellschaftliche Konstruktion
›erblicher Identität‹ grenzt eine Ethnie von einer politischen
Vereinigung ab (vgl.
Elwert
1989). Im Unterschied zu Klassen und anderen Interessengruppen bezieht sich
Ethnie auf Personen beiderlei Geschlechts, unterschiedlichen Alters sowie verschiedener
Berufe und Statusniveaus. Eine Abgrenzung ist oft schwer (z. B. Afghanistan,
wo mal 20, mal 50, mal 200 Ethnien genannt werden, vgl.
Schetter
2002: 474). Ethnische Gruppen müssen im Gegensatz zu
 indigenen
Völkern
indigenen
Völkern/Gruppen nicht unbedingt einen historischen Raumbezug aufweisen.
Es gibt zwei Positionen in der Ethnizitätsforschung: Die strukturelle/objektivistische
betrachtet Ethnie als eine durch bestimmte Handlungsmuster, Institutionen und
soziale Rollen empirisch fassbare Kategorie, während die kognitive/subjektivistische
Position sich auf die Summe kollektiver Denkinhalte einer ethnischen Gruppierung
bezieht. Wir-Bewusstsein, gemeinsame biologische Verwandtschaft, gemeinsames
Territorium, gemeinsame Geschichte, gemeinsame Kultur (Traditionen, Deutungsmuster,
Werte, Symbole etc.) sind häufige Referenzpunkte, über die sich ethnische
Gruppen definieren. Die Identifizierung eines Individuums mit einer ethnischen
Gruppe ist weder ständig wirksam noch unveränderlich, sondern in hohem
Maße situationsabhängig (
 Identity
Switching
Identity
Switching).
Da Ethnien oft in verstreuten Territorien leben oder sogar nur Netzwerke bilden,
rücken Ethnologen zunehmend davon ab, Gruppen oder Teilgruppen als ausschließliche
Forschungseinheiten zu nehmen. Jetzt erforscht man vermehrt interethnische Systeme,
multiethnische Netze, globale Verknüpfungen oder soziale Bewegungen, die
über einzelne Gruppen hinwegreichen. In der Feldforschung ist es zunehmend
notwendig, Menschen und Probleme an mehreren Orten gleichzeitig empirisch zu
verfolgen (
 Multisited
Ethnography
Multisited
Ethnography).
 zum
Seitenanfang
Ethnische Mobilisierung / Abgrenzung
zum
Seitenanfang
Ethnische Mobilisierung / Abgrenzung
Nach Terkessidis geht es dabei um politisch mobilisierungsfähige Konstruktionen
der eigenen
 Ethnizität
Ethnizität,
die zum Teil erst im Zuge der Moderne entstanden sind. Sie erlangen zunehmende
Bedeutung im Wettbewerb um Gelder, Privilegien, Ressourcen, im Verteilungskampf
um Anteile und Anrechte. Teilweise schließen sich deshalb - dem Gesetz
der großen Zahl in Demokratien folgend - immer mehr Minderheiten zu Großgruppen
zusammen (Afroamerikaner, Gay-Bewegung ...). Ethnische Abgrenzung ist eher eine
Frage der Identifizierung mit einer Facette der eigenen Herkunft, eine bewusste
Entscheidung (vgl.
Mayer/Terkessidis
1998; als Fallbeispiel zu Estland nach der Perestrojka:
Dittmer
2003).
 Ethnisierung
Ethnisierung;
 Ethnie
Ethnie
oder
 Nation
Nation
 zum
Seitenanfang
Ethnisierung
zum
Seitenanfang
Ethnisierung
Auch als
 "Kulturalisierung"
"Kulturalisierung";
oder "kulturelle Essentialisierung" bezeichnetes Phänomen. Es
besteht in einer Reduktion von Unterschieden zwischen Kategorien oder Gruppen
von Menschen auf ethnische oder kulturelle Unterschiede. Es wird zwischen
 Selbstethnisierung
Selbstethnisierung
und Fremdethnisierung unterschieden.
 zum
Seitenanfang
Ethnizität, ethnische Identität
zum
Seitenanfang
Ethnizität, ethnische Identität
Ethnizität leitet sich ab vom griechischen "ethnos = Volk" und
bezeichnet die individuell empfundene Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe,
deren gemeinsame Merkmale z. B. Sprache, Religion bzw. gemeinsame Traditionen
sein können. Bei Kultur geht es um sozial hergestellte Bedeutung, bei Ethnizität
um soziale Abgrenzung (Inklusion und Exklusion), die zu Wir-Gruppenbildung führt.
Ethnische Identität ist eine Form von
 kollektiver
Identität
kollektiver
Identität.
Im Prozess der kulturellen Differenzierung werden gruppen- bzw. identitätskonstituierende
Merkmale (sog. Identitätsmarker) wie
 Heimat
Heimat,
Abstammung, Religion und Sprache in beliebiger Anzahl und Kombination hervorgehoben
und im Rahmen einer primordialen Rhetorik zur Grundlage einer um Ursprünglichkeit
bemühten Definition des Eigenen und des Fremden gemacht. Sie erlaubt deshalb
auch situationale Umdefinitionen gemäß wechselnder Interessenkonstellationen.
Giordano (
1981)
spricht in diesem Zusammenhang von "rationalem Identitätsmanagement".
Gerade ihre enorme Aktualisierbarkeit verweist jedoch auf die emotionalsymbolische
Kraft ethnischen Gemeinschaftsglaubens, der sich in politischer Verwendung nicht
erschöpft (vgl. auch
 Selbst-Ethnisierung
Selbst-Ethnisierung).
Insgesamt zeigt Ethnizität sich also als eine Kombination von primordialer
Rhetorik, welche die kulturelle Besonderheit und lange Geschichte betont, und
pragmatischen situationsbezogenen Opportunismus im Aushandeln. Ebenso sind ethnische
Grenzziehungen (im Gegensatz zum
 Nationbegriff
Nationbegriff)
nicht exklusiv. Man kann sich umgreifende, überkreuzende oder auch für
den Wechsel offene Zugehörigkeiten (Identitäten) zuschreiben (vgl.
Schlee 1985).
Staaten versuchen Ethnizität in ihrem Sinne zu regulieren. Zur Zeit der
Entstehung dieser Konzepte Anfang der 1970er Jahre waren ethnisch definierte
Interaktionen eher friedlich. Spätestens seit Ende der 1980er Jahre ist
das Konzept von Ethnizität weltweit wesentlich politisierter, sind die
Auseinandersetzungen härter geworden (vgl.
Tambiah
1989: 339).
Esser sagt dazu: "Es gibt in einer Gesellschaft ein Reservoir von gedanklichen
Modellen der Typisierung, Abgrenzung und von Gefühlen der Solidarität
zu ›ethnischen‹ Gruppen, die nicht erst aktuell konstruiert worden
sind. Sie sind in vielen kulturellen Selbstverständlichkeiten noch sichtbar,
wenngleich nicht virulent. Und deshalb stoßen die aktuellen ›Konstruktionen‹
bei den Menschen auch nicht auf komplettes Unverständnis, wenn sie damit
konfrontiert werden. Die Anknüpfungsmöglichkeit an durchaus schwache,
latente kulturelle Muster ist eine Bedingung für alle Versuche der Wiederbelebung
ethnischer Ideen und Ideologien. Gänzlich aus dem Nichts heraus kann Ethnizität
sicher nicht geschaffen werden. Aber ihren Sinn müssen die versunkenen
Erinnerungen über aktuelle Gemeinsamkeiten und Abgrenzungen gewinnen. Und
das können nur aktuelle gemeinsame und auch starke Interessen sein"
(
Esser 1996:
73).
 Nationalcharakter
Nationalcharakter;
 Identität,
kollektive
Identität,
kollektive;
 Primordialismus
Primordialismus
Der UNDP-Bericht zur menschlichen Entwicklung von 2004 argumentiert mit empirischen
Belegen, dass politische Handlungsansätze, die kulturelle bzw. ethnische
Identitäten innerhalb des Staatsgefüges anerkennen und die Entfaltung
der Vielfalt fördern, nicht zwangsläufig zu Fragmentierung, Schwächung
der Entwicklung oder autoritärere Herrschaft führen, wie häufig
behauptet. Spannungen entstünden im Gegenteil oft gerade durch die Unterdrückung
der Freiheit von Minderheiten, sich kulturell auszudrücken (
 Freiheit,
kulturelle
Freiheit,
kulturelle). Kulturelle/ethnische Identität spielt bei Konflikten
wie z.B. in Ruanda in den 1990ern eine Rolle, allerdings weniger als Ursache,
denn als Triebkräfte für politische Mobilisierung (vgl.
UNDP
2004: 3ff). (
 Konflikte,
ethnisierte
Konflikte,
ethnisierte;
 Kulturalismus
Kulturalismus).
 zum
Seitenanfang
Ethnologie
zum
Seitenanfang
Ethnologie
Auch Kulturanthropologie, bzw. Völkerkunde (engl. cultural anthropology,
social anthropology, frz. ethnologie; sp. antropologia cultural); die Wissenschaft,
die die Daseinsgestaltung menschlicher Kollektive (Gruppen, Netzwerke) im umfassendem
Sinn ausgehend von einem holistischen Kulturbegriff erforscht; früher zu
fremden, fernen und vermeintlich einfachen ("primitiven") Gesellschaften,
heute grundsätzlich zu jeglichen Kollektiven, auch zur eigenen Gesellschaft;
methodisch stehen intensive Mikrostudien (mittels "Feldforschung")
zu Teilbereichen von Gesellschaften und kulturvergleichende Studien (
 Cross-Cultural
Studies
Cross-Cultural
Studies) im Zentrum.
 zum
Seitenanfang
Ethnologie der Globalisierung
zum
Seitenanfang
Ethnologie der Globalisierung
"Der ganzheitliche Anspruch der Ethnologie ist im Zeitalter der weltumspannenden
Vernetzung immer schwerer einzulösen und stellt die Disziplin vor neue
theoretische und methodologische Aufgaben", stellen
Breidenbach/Zukrigl
2002b fest. Und sie fahren fort: "Immer seltener sind Kultur, Gesellschaft
und Ort deckungsgleich. In einer Welt, in der die Kontakte zwischen räumlich
weit voneinander entfernten Gesellschaften exponentiell zunehmen, lässt
sich das traditionelle Forschungsgebiet der Ethnologie (außereuropäische,
vormoderne Gesellschaften) nicht mehr isolieren. Zeitgenössische ethnologische
Forschung hat die künstliche Trennung zwischen Wir (im Westen) und den
Anderen (der Rest der Welt) überwunden und untersucht das moderne Leben
überall: afrikanische Managementtechniken, die Lebensentwürfe junger
Deutschtürken, chinesischen Europa-Tourismus oder die Bedeutung des Internets
in Trinidad." (
Breidenbach/Zukrigl
2002b).
 Multisited
Ethnography
Multisited
Ethnography
 zum
Seitenanfang
Ethnonationalismus
zum
Seitenanfang
Ethnonationalismus
Ethnische Gruppe und Ethnozentrismus sind nach Kellas (
1998)
mit Nation und Nationalismus vergleichbar. Der Unterschied liege in den engeren
Definitionen von ethnischer Gruppe und Ethnozentrismus, die eher in der sozialpsychologischen
Theorie verwurzelt sind als Nationalismus, der explizit ideologische und politische
Dimensionen hat. Ethnien seien in der Regel kleiner als Nationen, eher auf gemeinsame
Abstammung und Geschichte bezogen, ausschließender (exclusive) und zuschreibender,
d.h. ihre Mitgliedschaft ist auf diejenigen beschränkt, die bestimmte ›angeborene‹
Attribute miteinander teilen (vgl.
Kellas
1998: 5).
Allerdings zeigt die neuere Forschung zu
 Ethnizität
Ethnizität,
dass ethnische Zugehörigkeit gerade nicht exklusiv ist. Man kann sich umgreifende,
überkreuzende oder auch für den Wechsel offene Zugehörigkeiten
(Identitäten) zuschreiben (vgl.
Schlee
1985).
Auch Dittmer kritisiert in einer Arbeit zur Mobilisierung ethnischer Unterschiede:
"Die Erklärung der Unterschiede zwischen ›ethnischer Gruppe‹
und ›Nation‹ leuchtet allein schon empirisch nicht ein - ohne weiteres
lassen sich zahlenmäßig große Ethnien und demgegenüber
kleine Nationen als Beispiele finden. Mehr noch ist es auf der Analyseebene
bereits schwierig, das Maß der gemeinsamen Abstammung oder die Bedeutung
ihres Platzes in der Menschheitsgeschichte zu bestimmen, gerade wenn - wie von
Kellas unterstellt - kein qualitatives Merkmal ethnische Gruppen von Nationen
trennt. (...) Die Abgrenzung entlang ethno-nationaler Linien ist nichts anderes
als der Versuch, Herrschaft und ethnische Zugehörigkeit in Übereinstimmung
zu bringen. Ob diese Grenzziehung in Westeuropa anders, d. h. inklusiver, liberaler,
demokratischer wirkt als in den Ländern, die als ›ethnische‹
Nationen gekennzeichnet werden, weil stärkere Zivilgesellschaften bereits
vor Staatsgründung vorhanden waren, ist dabei fraglich" (
Dittmer
2003;
Internetquelle).
 Konflikte,
ethnische
Konflikte,
ethnische;
 Konflikte,
ethnisierte
Konflikte,
ethnisierte;
 Rassismus
ohne Rassen
Rassismus
ohne Rassen
 zum
Seitenanfang
Ethnopluralismus
zum
Seitenanfang
Ethnopluralismus
Der Begriff Ethnopluralismus setzt sich aus dem griechischen ethnos (Volk) und
dem lateinischen pluralis (aus mehreren bestehend, zu mehreren gehörig)
zusammen. Die Protagonisten des Ethnopluralismus vermeiden meist das negativ
konnotierte Wort Rasse und benutzen stattdessen die Begriffe Volk oder Kultur.
Insbesondere die intellektuelle Neue Rechte versteht den Begriff als Synonym
für ›Völkervielfalt‹. So wurde aus der ›rassischen
Vielfalt‹ der ethnische Pluralismus.
Universalistische Ansätze (Marxismus, Liberalismus, Humanismus) bzw. egalitäre
Ideale der Moderne (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) und ihre politischen
Pendants (gleiche Würde, gleiche Rechte eines jeden Menschen im Staat)
lehnen Vertreter des Ethnopluralismus mit dem Hinweis auf die biologische Verschiedenheit
des Menschen und in Berufung auf Ergebnisse der Verhaltensforschung ab. "Indem
sie Beobachtungen aus dem Tierreich auf das menschliche Zusammenleben übertragen,
behaupten sie, dass es dem natürlichen nicht veränderbaren Verhalten
entspreche, wenn Menschen Fremde oder Migranten ablehnen. Die Solidarität
innerhalb der eigenen Gruppe (Ethnie/Volk) wird ebenso wie die Abgrenzung nach
außen, das heißt die Fremdenfeindlichkeit, als ein natürliches
Verhalten angesehen. Die Zugehörigkeit zu einem Volk, die durch die Geburt
festgelegt sei, ist aus dieser Sicht die entscheidende Prägung des Menschen,
ihr gegenüber seien Willensentscheidungen, etwa die Annahme einer Staatsbürgerschaft,
bedeutungslos" (Innenministerium NRW).
Das Konzept, so erläutert das Innenministerium in seinem Internetglossar
weiter, "geht auf Ideen zurück, wie sie beispielsweise der Theoretiker
des italienischen Faschismus, Julius Evola, formuliert hat: ›Nicht jedem
ersten besten kann Menschenwürde zugesprochen werden, und auch wo sie vorhanden
ist, erscheint sie in verschiedenen Abstufungen.‹ Ethnopluralismus lehnt
die Integration von Menschen verschiedener Herkunft und Kultur ab, da die Völker
und Nationen dadurch ihre kulturellen Eigenarten, ihre Identität und letztlich
ihre Qualität verlören. Auf diese Weise dient der Ethnopluralismus
im rechtsextremistischen Verständnis dem Erhalt der ›nationalen Identität‹
(...).
Der Ethnopluralismus tritt in der Regel nicht im Gewande eines plumpen
 Rassismus
Rassismus
auf. Meistens geht er nicht von einer grundsätzlichen Höherwertigkeit
der eigenen Volksgruppe aus, billigt aber Menschen anderer Herkunft im Inland
tendenziell nicht die gleichen Menschenrechte zu bzw. verweist sie auf die jeweiligen
Herkunftsländer" (Innenministerium NRW;).
 Rassismus
ohne Rassen
Rassismus
ohne Rassen
 zum
Seitenanfang
Ethnopolitik
zum
Seitenanfang
Ethnopolitik
Politik von Nationalstaaten gegenüber
 indigenen
Völkern
indigenen
Völkern bzw. anderen Minderheiten (z. B. Migranten) im eigenen
Land.
 Ethnische
Minderheiten
Ethnische
Minderheiten;
 Ethnizität,
politisierte
Ethnizität,
politisierte (vgl. auch
Dittmer
2003)
 zum
Seitenanfang
Ethnoscapes
zum
Seitenanfang
Ethnoscapes
Der Begriff, übersetzt ›ethnische Räume‹, wurde vom indo-amerikanischen
Ethnologen Arjun Appadurai Anfang der 1990er geprägt. Ethnische Räume
beschreiben Gruppenidentitäten, die sich eher unabhängig von Territorien
entwickeln. Lokale Bedeutungen werden ihrer tradierten Umwelt enthoben und in
neuen Zusammenhängen präsentiert. Beispiele sind das weltweite Netzwerk
der Auslandschinesen, aber auch anderer
 Diasporen
Diasporen,
wie z. B. die Indoamerikaner die heute in enger Verbindung und Austausch zu
den Herkunftsräumen stehen. (Ein köstliches Beispiel solch einer transkulturellen
Situation gibt Appadurai für seine eigene Familie; vgl. Appadurai in der
Einleitung zu diesem Glossar).
"In dem Ausmaß, in dem Menschen heute mit ihren kulturellen ›Bedeutungen‹
im Raum unterwegs sind und in dem diese Bedeutungen selbst da auf Wanderschaft
gehen, wo die Menschen an ihren angestammten Orten bleiben, können geographische
Räume Kultur nicht wirklich beinhalten oder gar begrenzen" (
Hannerz
1995: 68). Räumliche Konstellationen bleiben zwar weiterhin bedeutsam,
sind aber zunehmend "entbettet" (Giddens), d. h. der lokale Schauplatz
wird auch durch Nichtanwesende strukturiert.
Die Thesen der Entterritorialisierung übersehen allerdings häufig,
dass die lokalen Gesellschaften als verwaltungstechnisch definierte Konsumeinheiten
fortbestehen. So stellt Pfaff-Czarnecka fest: "Gerade in Situationen der
gesellschaftlichen Umverteilung sind der menschlichen Kreativität keine
Grenzen gesetzt, wenn es gilt, Ressourcen zu akquirieren. Die eigene lokale
Gesellschaft als Vision einer homogenen Gemeinschaft darzustellen, basiert auf
einer gekonnten Verbindung zwischen lokalen Werten und den universelle Geltung
beanspruchenden Bedeutungen, die von außen hereinbrechen" (
Pfaff-Czarnecka o. J.).
Hier geht es um den strategischen Umgang mit
 kulturellen
Repertoires
kulturellen
Repertoires, die je nach Kontext benutzt werden.
 Heimat
Heimat;
 Kultur
als Fluxus
Kultur
als Fluxus;
 Essentialismus,
strategischer
Essentialismus,
strategischer
 zum
Seitenanfang
Ethnozentrismus
zum
Seitenanfang
Ethnozentrismus
Ethnozentrismus bezeichnet die Tendenz, die eigene Kultur als Zentrum aller
Dinge und als Maßstab für andere Kulturen zu betrachten. Die eigene
Kultur bzw.
 ›Wir-Gruppe‹
›Wir-Gruppe‹;
wird positiv von anderen Gruppen abgegrenzt. Er ist die "Tendenz zur Höherschätzung
des Heimatlich-Vertrauten, des Bodenständigen und Immer-so-gewesenen, verbunden
mit entsprechendem Misstrauen gegen alles Fremde, Andersartige, aus der gewohnten
Ordnung Fallende" (
Bischof
1992: 40).
Die Herabsetzung des Fremden, Andersartigen geschieht auf der einen Seite durch
"Verdinglichung und Essentialisierung": Wir-Sie-Kategorisierung; Ungleichbewertung
(Eigenes besser als Fremdes); Ungleichbehandlung (Diskriminierung); Ent-Individualisierung
(Person nur als Gruppenmitglied wahrgenommen). Auf der anderen Seite durch "Naturalisierung":
Ungleichheit in Bezug gesetzt mit äußeren Körpermerkmalen; Schluss
von äußerlichen Merkmalen auf innere (psychische) Eigenschaften;
Übertragung einzelner zugeschriebener Eigenschaften auf alle (Totalisierung);
Annahme der Ursprünglichkeit und Unveränderlichkeit der insgesamt
›natürlichen‹ Unterschiede (Fixierung;
 Primordialismus
Primordialismus)
(vgl.
Antweiler
2004).
Die sozialpsychologischen Wurzeln des Ethnozentrismus könnten im von Tajfel
untersuchten
 Minimalgruppenparadigma
Minimalgruppenparadigma
liegen. Ethnozentrismus ist wie "Rassismus" und "Ausländerfeindlichkeit"
eines der Wörter, die heute in den Medien, aber oft auch von Wissenschaftlern
ohne genaue Spezifizierung verwendet werden (für Beispiele siehe
Antweiler
2004).
 Polyzentrismus
Polyzentrismus;
 Rollendistanz
Rollendistanz;
 Empathie
Empathie;
 Ethnizität
Ethnizität;
 Othering
Othering
 zum
Seitenanfang
Ethnozid
zum
Seitenanfang
Ethnozid
Ethnozid bedeutet "kulturellen Tod", also das Ende der Existenz von
Kultur. Absichtlich herbeigeführter Ethnozid ist "der Versuch, die
kulturelle Existenz einer
 Ethnie
Ethnie
zu vernichten" (
Bolz
1999: 112), meist ausgelöst durch das "auf Rassismus beruhende
Überlegenheitsgefühl einer dominanten Gesellschaft gegenüber
ethnischen Minderheiten" (
Bolz
1999: 112).
Beispiel für den Versuch eines Ethnozids ist die Sicht mancher US-Amerikaner
bis in die 1960er Jahre hinein, die glaubten, das ›Indianer-Problem‹
durch Umerziehung und Umsiedlung der Reservationsbevölkerung in Großstädte
lösen zu können mit dem Ziel, dass sich die indianische Bevölkerung
in den ›Schmelztiegel‹ USA integrieren und ihre eigenständige
ethnische Existenz aufgeben würde (vgl.
Bolz
1999: 112).
 zum
Seitenanfang
Europäische Union
zum
Seitenanfang
Europäische Union
Der Kulturbegriff der Europäischen Union ist im Wesentlichen ein enger,
auf
 Kulturpolitik
Kulturpolitik,
 Kulturaustausch
Kulturaustausch
und
 Kulturerbe
Kulturerbe
bezogener. Es wird aber auch in einem weiteren Sinne von der ›Schaffung
eines gemeinsamen europäischen Kulturraums‹ gesprochen.
Nach Selbsteinschätzung in einem Papier der Europäischen Union wurde
der Wunsch nach kulturellen Maßnahmen auf europäischer Ebene bereits
in den 70er Jahren deutlich. Offiziell wurde der Kulturbegriff jedoch erst im
Jahr 1992 des Maastrichter Vertrags thematisiert. Darin wird die Europäische
Union aufgerufen, "einen Beitrag zur ›Entfaltung der Kulturen der
Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie
gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes‹ zu leisten."
Zur Schaffung eines wirklichen europäischen Kulturraums unterstützt
die Union ihre Mitgliedstaaten in diversen Bereichen, z. B. durch die Erhaltung
des kulturellen Erbes von europäischer Bedeutung; nichtkommerziellen Kulturaustausch;
Förderung/Austausch von künstlerischem und literarischem Schaffen,
Zusammenarbeit mit Drittländern und den für Kultur zuständigen
internationalen Organisationen. Im Jahr 2000 nahm die Kommission mit dem Rahmenprogramm
›Kultur 2000‹ ein neues Konzept für ihre Tätigkeit im Kulturbereich
an. "Ziel dieses Konzepts ist die Schaffung eines gemeinsamen kulturellen
Raums durch die Förderung des kulturellen Dialogs, des kreativen Schaffens,
der Verbreitung der Kultur, der Mobilität der Künstler und ihrer Werke,
des europäischen kulturellen Erbes, neuer Formen des kulturellen Ausdrucks
sowie der sozioökonomischen Rolle der Kultur." (vgl.
Europäische
Union 2004:
Internetquelle)
Yasemin Soysal geht 2003 in einer Standortbestimmung zur Kultur Europas der
Frage nach, was eigentlich europäische Identität bestimmt. Anders
als bei nationalen Kategorien von Identität findet Europa seine Legitimität
danach nicht primär in seiner tief verwurzelten Geschichte oder in seinen
historischen Kulturen. Das neue Europa ist zukunfts- und nicht vergangenheitsorientiert.
Was Europa zusammenhält, so Soysal aufgrund ihres Vergleichs aktueller
Bildungsinhalte, ist eine Reihe bürgerlicher Ideale, universalistischer
Glaubenssätze und Prinzipien. Allerdings sind diese so universal, dass
sie nicht mehr speziell Europa zugeordnet werden können. Dies macht es
unmöglich, eine territorial und kulturell gebundene Identität Europas
zu bestimmen. Dem neuen Europa mangele es an Originalität und seine Identität
scheint keine Herausforderung für nationale Identitäten zu sein. Noch
immer ist ein bedeutender Teil des Geschichtsunterrichts in Schulen der nationalen
oder regionalen Geschichte gewidmet. Aber die Lehrbücher stellen andererseits
Nation und Identität zunehmend in einen europäischen Kontext, und
in diesem Prozess wird auch die Nation neu interpretiert.
So resümiert Soysal: "Europa ist ein strittiges und unfertiges Projekt,
offen für Modifikationen und neue Entwicklungen. Doch was noch wichtiger
ist: Es sollte niemals mit einer schlüssigen und einheitlichen Darstellung
enden. Denn nur in dieser Art Europa (und der Art von pluraler Identität,
die es ermöglicht) finden sowohl der Osten und der Westen als auch der
Süden und der Norden ihren Platz und werden somit Bestandteil eines vielfältigen
kulturellen Europas" (
2003:
38) (...) "Je weiter die institutionelle Integration der EU mit ihren Institutionen
und Regierungsprinzipien fortschreitet, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit
einer gemeinsamen Identität und Kultur" (
Soysal
2003: 35;
Internetquelle).
Dies steht in deutlichem Kontrast zum derzeit politisch wieder lancierten Begriff
einer europäischen
 Leitkultur
Leitkultur.
 zum
Seitenanfang
Evaluierung
zum
Seitenanfang
Evaluierung
... (vom engl. evaluation). Die Bewertung von Prozessen und Ergebnissen, besonders
in sozialen Handlungsbereichen
Evaluierung in der Entwicklungszusammenarbeit steht heute vor dem Hintergrund
der ›4. Generation‹ von Evaluation. Nicht mehr Projekt-Outputs, sondern
Fragen zu Programmeffekten (impacts), Zielgruppenerreichung und Stakeholder-Sichtweisen
stehen dabei im Vordergrund. Weniger Objektivität der Ergebnisse, als vielmehr
Glaubwürdigkeit (trustworthiness), kulturelle Anschlussfähigkeit und
Handlungsrelevanz stehen nun im Vordergrund von Evaluation. Methodologische
Probleme bei Evaluierungen liegen unter anderem in der Frage, welche Verfahren
für welche Gegenstände angemessen sind und welche Leistung wie gewichtet
werden soll. Auch richtet die evaluierte Institution ihr Verhalten nicht selten
auf die Evaluierungspraxis aus: "Man tut, was gemessen, und unterlässt,
was vom Bewertungsraster nicht erfasst wird" (
Bröckling
et al. 2004).
Eine Ex-Post-Evaluierung von 32 abgeschlossenen Projekten der deutschen Staatlichen
Zusammenarbeit (
BMZ
2000) zeigte einen signifikanten Zusammenhang zwischen Zielerreichung und
Kulturangepasstheit: So hat sich herausgestellt, dass ein Zielkonsens zwischen
der deutschen Seite und dem lokalen Projektträger aber auch mit den Zielgruppen
von Beginn an von zentraler Bedeutung ist. Deshalb müsse den soziokulturellen
Rahmenbedingungen der gleiche Stellenwert zukommen wie ökonomischen und
naturwissenschaftlichen. Der erste Faktor hat mit der Fähigkeit zu einem
offenen und gleichwohl ›kultursensiblen Dialog auf Augenhöhe‹
zu tun; der zweite erfordert "die genaue Kenntnis der Problemsicht, der
Ressourcen und der kulturell geprägten Eigenheiten von Zielgruppen"
(
BMZ 2000:
10).
Partizipative Evaluierungsdesigns haben Auswirkungen auf veränderte TORs,
Auswahl der Gutachter, Art der Evaluierungsinstrumente und einen veränderten
Status der Befragten, z. B.: Welche Fragen interessieren den Partner? In welchem
Verhältnis stehen die externen Leistungen zum erforderlichen Mitteleinsatz
auf Seiten der Partner? Partizipatorische Evaluationsdesigns sind durchaus aufwendig,
sowohl was Vorbereitung, als auch was die Kosten betrifft. Ihr Einsatz bei Evaluationen
sollte gerechtfertigt sein. Sie eignen sich besonders für gewichtete und
genderspezifische Aussagen zu Wirkungen von Aktivitäten; zur Erhebung von
Sichtweisen einzelner Stakeholder und deren Vernetzung; für das Entdecken
versteckter Indikatoren und Kriterien; für Fragen der ›Performance‹
und der Zusammenarbeit zwischen einzelnen Stakeholdern/Akteuren. (Zum Weltbankkonzept
des Participatory M&E vgl.:
World
Bank 2003a;
Internetquelle)
EVAL bezeichnet ein neues elektronisches Evaluierungsverfahren, eine Interviewsoftware,
die die GTZ zusammen mit der Bremer Unternehmensberatung Neuhimmel (
www.nextpraxis.de)
entwickelt hat. Es wird schrittweise die bisherige Praxis, in der Ergebnisse
und Wirkungen mittels Fragebögen erfasst wurden, ablösen. Die drei
jeweils am besten informierten Personen der GTZ, des Partners und der Zielgruppen
bzgl. eines Projekts beantworten in einem Selbstinterview Fragen (z. B. woran
sie Erfolg oder Fehlschlag des Projektes bemessen würden). Die subjektive
Meinung bildet einen Bedeutungsraum ab, den der Computer grafisch darstellen
kann. Dabei wird der ›Kultur‹ im EVAL nicht explizit benannt, sondern
als eine der Intervention in fremde soziale Systeme inhärente Komponente
der EZ vorausgesetzt. (vgl.
Dümcke
2003: 23).
 zum
Seitenanfang
Evolution
zum
Seitenanfang
Evolution
Ein sehr unterschiedlich verwendeter Terminus; meist verstanden als gesellschaftlicher
Wandel, der langfristig, gleichmäßig bzw. stetig verläuft; im
Gegensatz zu Revolution; oft als Komplexitätssteigerung aufgefasst (im
Gegensatz zu "Devolution"); besonders oft in wertender Weise mit Höherentwicklung
("Fortschritt";
 Hochkultur
Hochkultur)
gleichgesetzt und dann auch synonym mit
 "Entwicklung"
"Entwicklung";
gebraucht.
 zum
Seitenanfang
Exil
zum
Seitenanfang
Exil
Unter Exil versteht man nach Kokot "... den Aufenthalt in einer als fremd
wahrgenommenen Umgebung, dessen Anlass nicht als freiwillige Entscheidung wahrgenommen
wird und dessen zeitliche Dauer nicht der eigenen Kontrolle unterliegt. Das
heißt: Menschen im Exil können zumindest in ihrer eigenen Wahrnehmung
nicht zurück. Der Faktor der Fremdheit spielt in der Erfahrung des Exils
eine entscheidende Rolle. Um die unbestimmte Möglichkeit der Rückkehr
nicht ganz aus den Augen zu verlieren, muss ein symbolischer Bezug zur ›Heimat‹
immer neu konstruiert werden. Ein primäres Mittel dazu ist die Konstruktion
von Geschichte und die Erfindung und Vitalisierung gemeinsamer Traditionen.
Nicht alle Menschen im Exil sind im engeren Sinne Flüchtlinge. Im Exil
geborene Kinder und Enkel haben die traumatischen Ereignisse der Flucht nicht
selbst erlebt. Dennoch teilen sie die Erfahrung des nicht-freiwillig-in-der-"Fremde"-Lebens.
Es bliebe in diesem Zusammenhang beispielsweise zu klären, inwieweit Geschichten
über die Flucht und den Neuanfang als Erzählmuster über Generationen
tradiert werden und somit auch für die Kinder und Enkel identitätsstiftend
wirken" (
Kokot 2003).
 Diaspora
Diaspora;
 Heimat
Heimat
 zum
Seitenanfang
zum
Seitenanfang