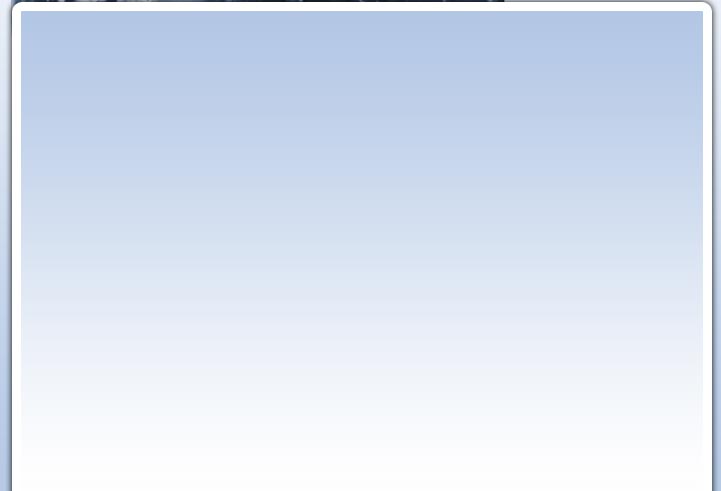Verwaltungskultur
Verwaltungskultur leitet sich aus dem Konzept der
 Organisationskultur
Organisationskultur
ab. Sie bildet nach Wille (
2003)
ein Subsystem der Landeskultur und ist von ihr geprägt: "Die in einschlägiger
Fachliteratur diskutierte Kontroverse, ob Organisationen von Landeskulturen
geprägt sind, wird begrifflich mit ›culture bound‹-These vs.
›culture free‹-These gefasst. Ausgehend von der Kulturgebundenheit
des Menschen sind auch Organisationen, an denen Menschen partizipieren, geprägt
von der sie umgebenden Kultur. Im Gegensatz dazu betrachten Verfechter der ›culture
free‹-These Organisationen völlig frei von kulturellen Einflüssen:
Sie gehen davon aus, dass Organisationen universalen Bedingungen unterliegen,
die keine kulturspezifischen Ausprägungen erfahren. Die skizzierten Auffassungen
repräsentieren Extrempositionen, die in ihrer Reinform kaum haltbar sind.
Laut Köppel liegen vor allem in den Wirtschaftswissenschaften empirische
Belege dafür vor, dass universale Ähnlichkeiten eher im Makrobereich
(Organisationsstrukturen, Technologien) und Unterschiede eher auf der Mikroebene
(bspw. Verhalten von Mitarbeitern) zu finden sind (vgl.
Köppel
2002: 35 ff.)" (
Wille
2003; Verwaltungskultur;
Internetquelle).
 zum
Seitenanfang
Vielfalt, intrakulturelle
zum
Seitenanfang
Vielfalt, intrakulturelle
"Im Gegensatz zu ›inter‹ verweist die Vorsilbe ›intra‹
nicht auf ein drittes ›Dazwischen‹, sondern auf ein ›Innerhalb‹.
Im Sinne des weiten
 Kulturbegriffs
Kulturbegriffs
ist damit folglich die Interaktion zwischen Angehörigen von
 Subkulturen
Subkulturen
innerhalb eines Lebenswelt-Netzwerkes als intrakulturell zu bezeichnen. Diese
Differenzierung ist allerdings notwendig unscharf und muss es auch bleiben,
weil die Grenzen zwischen Inter- und Intrakulturalität fließend sind.
Erklärbar wird aber, dass und warum z. B. oberflächenstrukturell ein
deutscher und ein chilenischer Bäcker mehr Gemeinsamkeiten aufweisen und
sich eventuell besser verstehen als der gleiche deutsche Bäcker mit seinem
Nachbarn, einem deutschen Mathematiker" (
Interkulturelle
Kompetenz Online 2004;
Internetquelle).
Gerade die binnenkulturellen Differenzen werden von den an Nationalstereotypen
orientierten Ansätzen (
 Kulturdimensionen
Kulturdimensionen;
 Kulturstandards
Kulturstandards)
meist völlig ausgeblendet. Aber auch in der EZ wird intrakulturelle Vielfalt
oft vernachlässigt; man denkt in Kategorien, früher in Rassen, dann
in Ethnien und Gemeinschaften. Dennoch ist es gerade für EZ-Vorhaben wichtig,
die Heterogenität zu beachten. Die Vielfalt bezieht sich z. B. auf unterschiedliche
Sprachen oder Dialekte, unterschiedliche Religionen, Traditionen etc., aber
auch auf verschiedene Schichten und Generationen.
 zum
Seitenanfang
Vielfalt, kulturelle / Social Diversity / Cultural
Diversity
zum
Seitenanfang
Vielfalt, kulturelle / Social Diversity / Cultural
Diversity
Taylor Cox Jr., einer der führenden Diversity-Wissenschaftler in den USA,
fasst den Begriff als den Mix von Menschen innerhalb eines Sozialsystems, die
erkennbar unterschiedliche, sozial relevante Gruppenzugehörigkeiten haben
(vgl.
Cox/Beale
1997: 1). Wird die Unterscheidung auf der Basis von Sprache, Verhaltensnormen,
Werten, Lebenszielen, Denkstilen oder Weltanschauungen vorgenommen, hat sie
also kulturelle Relevanz, sprechen die Autoren von kultureller Diversität
(vgl.
Cox/Beale
1997: 2).
Ethnologische Studien zur Vielfalt in Kulturen können für das Verständnis
und die Verbesserung formaler Organisationen fruchtbar gemacht werden. "Diversität
ist nicht einfach größer oder kleiner: Gesellschaften und Organisationen
sind unterschiedlich verschieden! In der öffentlichen Debatte über
Kultur wie auch in der Organisationsforschung steht ›Kultur‹ meist
für Unterschiede, für Differenz. Die Betonung der Unterschiede zwischen
Kulturen führt jedoch zu blinden Flecken. Erstens bleiben die Gemeinsamkeiten
zwischen Kulturen unbeachtet. Zweitens übersieht man die Unterschiede innerhalb
von Kulturen" (
Antweiler
2003c).
 Vielfalt,
intrakulturelle
Vielfalt,
intrakulturelle
›Diversity‹ wird fast immer bewertet, meistens positiv (während
z. B. ›Heterogenität‹ oft als negativ gilt). Der englische Begriff
umfasst ein Bedeutungspaar, das ganz unterschiedliche normative Setzungen erlaubt:
einerseits Unterschiedlichkeit im Sinne von Andersartigkeit (differentness),
andererseits Mannigfaltigkeit (biodiversity) im Sinne von Typen- oder Artenvielfalt.
Einigkeit besteht in der neueren Diversity-Forschung über folgende Aussagen:
1. dass jedes Attribut / jede Kategorie, die in einer Gruppe unterrepräsentiert
ist, potentiell zur Basis für Kategorisierung werden kann;
2. dass bestimmte demografische Charakteristika (phys. Erscheinung, Geschlecht,
Alter) auffälliger sind und deshalb leichter zur sozialen Kategorisierung
herangezogen werden;
3. dass Rasse/Ethnizität, Gender, Klasse und sexuelle Orientierung institutionell
wie kulturell konstruiert und deshalb prinzipiell veränderbar sind;
4. dass jede dieser Dimensionen sozialer Organisation dichotom konstruiert ist
(weiß/nichtweiß; Frauen/Männer; usw.);
5. dass sich jede Dimension auch aus Anteilen der anderen konstituiert (›ungeschlechtliche
weiße Person‹);
6. dass die Ideen und Regeln, durch die soziale Identitäten im Westen konstruiert
werden, Teil eines größeren, dem Aufklärungsparadigma verpflichteten
Denk- und Organisationsmusters sind (vgl.
Cox/Beale
1997; auch
Schönhuth
2003).
Die UNESCO-Deklaration zur kulturellen Vielfalt von
2001
(
Internetquelle)
betrachtet sie als ebenso wichtig wie die Biodiversität; sie stellt einen
Nutzen gegenwärtiger und künftiger Generationen dar. Kulturelle Vielfalt
wird als eine der Wurzeln von Entwicklung betrachtet, wobei diese nicht allein
im Sinne des wirtschaftlichen Wachstums gefasst werden soll, sondern als Weg
zu einer erfüllteren intellektuellen, emotionalen, moralischen und geistigen
Existenz.
Pragmatischer geht die Betriebswirtschaftslehre an den Begriff heran. Aus ihrer
Sicht stellt Diversität noch keinen Wert an sich dar. Denn meist müssen
für vielfältigere Möglichkeiten auch höhere Kosten kalkuliert
werden. Andererseits kann es aus strategischen Gründen für ein Unternehmen
auch wichtig sein, über mehrere Handlungsalternativen zu verfügen.
Im Vordergrund stehen für die Betriebswirtschaftler deshalb die Fragen:
Wozu wird Vielfalt benötigt? Was kostet Vielfalt? Welcher Zusatznutzen
ergibt sich?
 UNESCO/Kultur
UNESCO/Kultur;
 Entwicklung
Entwicklung;
 Intrakulturelle
Vielfalt
Intrakulturelle
Vielfalt;
 kultureller
Pluralismus
kultureller
Pluralismus
 zum
Seitenanfang
Vielfalt, kulturelle
und staatliches Handeln
zum
Seitenanfang
Vielfalt, kulturelle
und staatliches Handeln
Wicht (
2004)
unterscheidet sieben Bedeutungsgehalte von kultureller Vielfalt im modernen
Nationalstaat:
a) im Sinne von Multikulturalität (typisch für die US-Politik der
1970er bis 1990er Jahre: "affirmatives Handeln gegenüber Minderheitengruppen");
b) im Sinne einer die schöpferische Vielfalt unterschiedlichster Gruppen
reflektierenden
 Kulturpolitik
Kulturpolitik
(Kanada und Australien als Beispiele, in der dieser Diversity-Ansatz staatliches
Handeln bestimmt).
c) im Sinne der Ausnahmestellung und dem Schutzwürdigkeit von Kulturgütern
im internationalen Warenverkehr (z.B. Schutz /Förderung der einheimischer
Filmindustrie);
d) im Sinne der Garantie
 kultureller
Rechte
kultureller
Rechte (als dritte Säule der Menschenrechte neben den politischen
und sozialen Rechten; Recht auf kult. Identität und Kulturerbe);
e) im Sinne des Schutzes von Minderheiten und Minderheitensprachen (dazu existieren
im Europarat bereits Rahmenkonventionen);
f) im Sinne des friedlichen Zusammenlebens und -wirkens unterschiedlicher Gruppen
unter einem föderalen Dach ("dialogischer Schweizer Ansatz" als
Modell);
g) im Sinne der Nachhaltigkeits-Beziehung zwischen Kultur und
 Entwicklung
Entwicklung
("Our creative diversity"; de Cuellar-Report der UNESCO 1995).
Die UNESCO-Deklaration zur kulturellen Vielfalt von
2001
(
Internetquelle)
betrachtet kult. Vielfalt für eine nachhaltige Entwicklung als ebenso wichtig
wie die Biodiversität. Kulturelle Vielfalt wird als eine der Wurzeln von
Entwicklung betrachtet, wobei diese nicht allein im Sinne des wirtschaftlichen
Wachstums gefasst werden soll, sondern als Weg zu einer erfüllteren intellektuellen,
emotionalen, moralischen und geistigen Existenz. Die Thematik wird auch im UNDP-Bericht
über die menschliche Entwicklung von 2004 ("Kulturelle Freiheit in
unserer Welt der Vielfalt") in diesem Sinne fortgeführt.
Zwischen kultureller Vielfalt und wirtschaftlicher Entwicklung ist wissenschaftlich
kein eindeutiger Zusammenhang herstellbar - weder positiv noch negativ. Der
Zusammenhang zwischen schwacher Wirtschaftsleistung und Vielvölkerstaat
lässt sich an afrikanischen Beispielen genauso widerlegen (z.B. Mauritius),
wie an asiatischen (z.B. Malaysia; vgl.
UNDP
2004: 6; 177ff.). Studien belegen aber auch, dass ethnische Vielfalt Kosten
verursacht, weil Regierungen vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen mit Ansprüchen
unterschiedlichster, miteinander konkurrierender Gruppen umgehen müssen.
Menschen sind anscheinend z.B. bereit, mehr für staatliche Dienstleistungen
auszugeben, wenn sie mit Menschen ähnlicher Sozialkategorien (ethnisch,
Klasse...) zusammenleben können (
Alesiana/Spola
2003).
Auch für die UNDP ist kulturelle Vielfalt kein Wert an sich. Erst in der
positiven Verbindung mit
 kultureller
Freiheit
kultureller
Freiheit, der Möglichkeit, eine Wahl zu treffen gewinnt sie ihre
humanistische Qualität (
UNDP
2004: 33).
 UNESCO/Kultur
UNESCO/Kultur;
 Entwicklung
Entwicklung;
 Intrakulturelle
Vielfalt
Intrakulturelle
Vielfalt;
 kultureller
Pluralismus
kultureller
Pluralismus;
 Freiheit,
kulturelle
Freiheit,
kulturelle.
 zum
Seitenanfang
Volk
zum
Seitenanfang
Volk
"Volk ist ein emotional hoch aufgeladener Ausdruck mit stark schwankendem
Inhalt. Mal ist er eher
 Ethnie
Ethnie,
mal eher
 Nation
Nation,
dann gar die ›breite Masse‹, die ›einfachen‹ Mitglieder
einer Gesellschaft ["wir sind das Volk ..." ms], oder sind Träger
der bäuerlichen Kultur gemeint. Der Terminus hat insbesondere im deutschen
Sprachraum eine Karriere als asymmetrischer Gegenbegriff zu Staat hinter sich"
(
Elwert 1999b:
400).
Für Hansen (
2000)
besteht die Kollektivität eines Volkes aus dem Repertoire seiner gemeinsamen
geistigen Ressourcen, aus dem sich die Individuen bedienen, unbeschadet der
Rasse oder ethnischen Herkunft, Schicht, Geschlecht oder Individualität.
Im Gegensatz zur
 Nation
Nation,
die als eine rein politische im 19. Jahrhundert entstandene staatliche Organisationsform
bezeichnet werden könne, fasst er Volk als ein Kollektiv mit "belastbarer
innerer Kohäsion" auf, das auch ohne äußeren politischen
Zwang zusammenhält. Dieser innere Zusammenhang gründet vor allem auf
dem Faktor Zeit, der ein Mehr an kommunikativ entwickelten und dem Mitglied
als Verhaltensangebot unterbreiteten Verhaltensweisen ermöglicht. Es bilden
sich Gemeinsamkeiten heraus (Sprache, Rituale, Bräuche, Umgangsformen,
gemeinsame Diskurse, Mentalitäten), die eine eigene Lebenswirklichkeit
schaffen und transgenerationell weitergegeben werden. Dieses kulturelle Gedächtnis
ist die Voraussetzung für ein Selbstbild, das bei Solidaritätsbedarf
(Abgrenzung gegenüber Fremdbildern) zur Volksidentität heranreifen
kann, mit entsprechend konstruierten Mythen der Volksgründung, Geschichte
etc. (vgl.
Hansen
2000: 225 ff.)
 zum
Seitenanfang
Völker, indigene
zum
Seitenanfang
Völker, indigene
Indigene Völker (im Englischen auch: ›indigenous peoples,‹ ›indigenous
ethnic minorities,‹ ›tribal groups,‹ ›scheduled tribes‹)
ist eine relativ junge Lehnübersetzung, wahrscheinlich vom spanischen ›Pueblos
indígenas‹. In internationalen politischen Zusammenhängen ist
›Indigene Völker‹ / ›Indigenous Peoples‹ / ›Pueblos
Indígenas‹ die übliche Sammelbezeichnung für Ureinwohnervölker
aller Kontinente, während in nationalen Zusammenhängen oft andere
Sammelbegriffe verwendet werden (z. B. Aborigines, Native Americans, First Nations,
Adivasi). Die heute meistgebrauchte Definition diese Begriffs geht auf UN-Sonderberichterstatter
José Martinez-Cobo zurück, der diesen 1986 an vier Kriterien knüpfte
(hier in der präzisierten Form der Working Group on Indigenous Populations;
WGIP 1996):
1. Zeitliche Priorität in Bezug auf die Nutzung oder Besiedlung eines bestimmten
Territoriums: Indigene Völker sind relativ die ›ersten‹ Bewohner
eines Gebiets.
2. Die freiwillige Bewahrung kultureller Besonderheit (voluntary perpetuation
of cultural distinctiveness), die die Bereiche Sprache, Gesellschaftsorganisation,
Religion und spirituelle Werte, Produktionsweisen und Institutionen betreffen
kann: Indigene Völker sind kulturell deutlich von der Mehrheitsgesellschaft
unterschieden.
3. Selbstidentifikation und Anerkennung durch andere als eine distinkte Gemeinschaft:
Die Betroffenen müssen selbst mehrheitlich der Ansicht sein, dass sie einer
distinkten Gruppe (einem Volk) angehören und dass dieses als ›indigen‹
anzusehen ist. Gleichzeitig muss diese Ansicht von anderen, etwa von Angehörigen
anderer indigener Völker in nennenswertem Umfang geteilt werden.
4. Eine Erfahrung von Unterdrückung, Marginalisierung, Enteignung, Ausschluss
oder/und Diskriminierung, wobei diese Bedingungen fortbestehen oder nicht: Der
Grad der heute fortbestehenden Unterdrückung kann höchst unterschiedlich
sein, von struktureller Benachteilung bei Aufstiegsmöglichkeiten bis hin
zu Zwangsvertreibung und Ausrottung. Als Gruppe erfahrene Unterdrückung
ist in jedem Fall konstitutiv für das politische Selbstverständnis
indigener Völker.
Eine exklusive, ›harte‹ Definition des Begriffs ›Indigene Völker‹
kann und soll es nach Ansicht ihrer VertreterInnen, aber auch der UNO-Arbeitsgruppe
über indigene Bevölkerungen nicht geben. Ein zentrales Element der
Unterscheidung indigener Gemeinschaften von der nicht-indigenen Mehrheitsgesellschaft
ist oftmals die besonders enge Bindung indigener Kulturen an ihr jeweiliges
Territorium sowie die besonders enge Beziehung zu diesem, die zumeist auch spirituelle
Dimension besitzt. (Text leicht gekürzt nach
Wikipedia
2004: indigene Völker;
Internetquelle).
Die Gruppe indigener Völker umfasst etwa 350 Millionen Menschen in mehr
als 70 Ländern der Welt und repräsentiert mehr als 5000 Sprachen und
Kulturen. Viele von ihnen leben heute am Rande der Gesellschaft und sind von
grundlegenden Menschenrechten und speziell kulturellen Rechten abgeschnitten.
International beschäftigen sich Organisationen wie die 1969 gegründete
Survival International um die Belange indigener Gruppen (
www.survivalinternational.org).
In Deutschland und der Schweiz ist dies vor allem die Gesellschaft für
bedrohte Völker (
www.gfbv.org;
bzw.
www.gfbv.ch).
EZ mit indigenen Völkern setzt oft eine Analyse des rechtlichen Rahmens
(etwa den Rechten der Indigenen an dem von ihnen bewohnten Land) voraus. Indigene
Völker unterscheiden sich von
 ethnischen
Gruppen
ethnischen
Gruppen oder
 Minderheiten
Minderheiten
durch den historischen Raumbezug, den letztere nicht notwendigerweise haben.
(vgl. dazu auch das BMZ-Konzept zur Entwicklungszusammenarbeit mit indianischen
Bevölkerungsgruppen in Lateinamerika 1996; BMZ-Konzepte Nr. 73).
 Indigene
Völker oder indigene Menschen?
Indigene
Völker oder indigene Menschen?
 zum
Seitenanfang
Volksgemeinschaft
zum
Seitenanfang
Volksgemeinschaft
Nach einer Definition des Nordrhein-westfälischen Innenministeriums wird
darunter "... ein streng hierarchisch gegliedertes Gemeinwesens verstanden,
in dem der Staat und ein ethnisch homogenes Volk zu einer Einheit verschmelzen
und in dem alle Klassen und Standesschranken aufgehoben sind. Die staatliche
Führung handelt intuitiv nach dem einheitlichen Willen des Volkes, der
Einzelne ordnet seine Interessen dem Wohl der Volksgemeinschaft unter. (...)
Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Volksgemeinschaft als gesellschaftliches
Ideal den damaligen sozialen Gegensätzen entgegengehalten. Der individualistischen
und allein von wirtschaftlichem und politischem Nutzen dominierten Gesellschaft
wurde die durch gewachsene Strukturen gekennzeichnete Gemeinschaft von Familie,
Nachbarschaft oder Volk gegenübergestellt (Ferdinand Tönnies, 1887).
(...)
Zur nationalsozialistischen Volksgemeinschaft konnte nur zählen, wer der
›arischen Rasse‹ angehörte und sich uneingeschränkt zur
nationalsozialistischen Weltanschauung bekannte. Somit waren ›fremdvölkische‹
Menschen vor allem Juden von vornherein ausgeschlossen. (...)
Das wirkliche Ziel dieser Ideologie war aber nicht eine Gemeinschaft freier
Individuen, sondern eine ›opferbereite Volks und Leistungsgemeinschaft‹,
die mechanisch den Befehlen ihres Führers gehorcht. Bis heute berufen sich
Teile des Rechtsextremismus auf die Ideologie der Volksgemeinschaft: (...)
Unverändert gewinnt die Ideologie der Volksgemeinschaft ihre Attraktivität
aus dem Bedürfnis nach Geborgenheit und Zusammenhalt vor allem dann, wenn
vorhandene gesellschaftliche Strukturen als anonym und seelenlos empfunden werden.
Ein Gemeinwesen nach dem Prinzip der Volksgemeinschaft wäre jedoch zwangsläufig
durch eine autoritäre Führung der Eliten ohne hinreichende demokratische
Legitimation und die Ausgrenzung von Menschen anderer Ethnien und Andersdenkender
gekennzeichnet." (
Innenministerium
Nordrheinwestfalen 2004).
 zum
Seitenanfang
Vorurteile
zum
Seitenanfang
Vorurteile
Im Alltagsverständnis bezeichnet ein Vorurteil ausgeprägte positive
und negative Urteile oder Einstellungen eines Mitmenschen, wenn diese für
nicht realitätsgerecht gehalten werden und der Betreffende trotz Gegenargumenten
nicht von seiner Meinung abrückt (vgl.
Bergmann
2001: 3;
Internetquelle).
In der wissenschaftlichen Vorurteilsforschung (v.a. Psychologie, Sozialpsychologie
und Soziologie) werden darunter nur solche soziale Urteile subsumiert, die gegen
anerkannte menschliche Normen verstoßen, insbesondere Normen der Rationalität
(d. h. vorschnelles Urteilen), der Gerechtigkeit (Gleichbehandlungsgrundsatz
nicht eingehalten) und der Mitmenschlichkeit (Intoleranz und Ablehnung des Anderen
als Mitmensch, Fehlen von Empathie). "Vorurteile sind demnach stabile und
konsistent negative Einstellungen gegenüber einer anderen Gruppe bzw. einem
Individuum, weil es zu dieser Gruppe gerechnet wird" (
Bergmann
2001: 3;
Internetquelle).
Gordon W. Allport hat in seiner klassischen Arbeit "The nature of prejudice"
von 1954 das Vorurteil durch folgende Merkmale charakterisiert:
1. Es ist ein voreiliges Urteil, d. h. ein Urteil, das überhaupt nicht
oder nur sehr ungenügend durch Reflexionen oder Erfahrungen gestützt
oder sogar vor jeglicher Erfahrung/Reflexion aufgestellt wird.
2. Es ist meist ein generalisierendes Urteil, d. h. es bezieht sich nicht nur
auf einen Einzelfall, sondern auf viele Urteilsgegenstände.
3 Es hat häufig den stereotypen Charakter eines Klischees und wird vorgetragen,
als sei es unwiderlegbar.
4. Es enthält neben beschreibenden oder theoretisch erklärenden Aussagen
direkt oder indirekt auch richtende Bewertungen von Menschen, Gruppen oder Sachverhalten.
5. Es unterscheidet sich von einem Urteil durch die fehlerhafte und vor allem
starre Verallgemeinerung.
Allport empfiehlt, Vorurteile gegenüber Personen durch gemeinsame Tätigkeiten
zu überwinden. Seiner Ansicht nach reicht es nicht, nur Informationen über
die betreffende Person einzuholen, da Vorurteile stärker als "Voreingenommenheit"
seien. (
Wikipedia
2004: Vorurteil;
Internetquelle)
Bergmann betont, dass die heutige Vorurteilsforschung weniger nach der Struktur
und dem Inhalt von Vorurteilen, als vielmehr nach den Funktionen dieses ›falschen‹
Denkens fragt. Nach Schmalz-Jacobsen/Hansen (
1997:
246 ff.) haben Vorurteile folgende Funktionen. Sie dienen:
- der Orientierung in unübersichtlichen Situationen und Verhältnissen.
Damit erlauben sie Verhaltenssicherheit; sichern die Herstellung und Aufrechterhaltung
von Selbstwertgefühl.
- der Gruppenbildung durch Ein- und Ausgrenzungen. Sie ermöglichen
Diskriminierung ohne Gewissenskonflikt. Vorurteile erlauben Agressionsverschiebung
auf Fremdgruppen zur Sicherung der Eigengruppe. Mit diesen Eigenschaften
als Ausgangspunkt kommt es zu Ungleichbehandlung.
- der Legitimation und Rechtfertigung von Herrschaftsausübung. Sie
helfen, den Status quo der Machtverteilung zwischen Minderheiten und Mehrheiten
zu erhalten.
- der Stabilisierung von Herrschaftsverhältnissen durch Bereitstellung
von ›Sündenböcken‹. Sie führen zu Solidaritätserwartungen
innerhalb von Gruppen.
Vorurteile werden insbesondere auch im Umgang mit ethnischen Minderheiten im
eigenen Land relevant. Sie können durch Aufklärung, Information oder
Begegnungen und konkrete Erfahrungen in Urteile verändert werden. Allerdings
betonen Schmalz-Jacobsen/Hansen auch, dass einmalige Schulungen oder Trainings
zu Vorurteilen nur zu Teilnehmern führen, die keine Vorurteile mehr zugeben.
"Die dauerhafte Überwindung eines Vorurteils setzt voraus, dass eine
als positiv erlebte Erfahrung mit Angehörigen einer Fremdgruppe nicht als
Ausnahme interpretiert, sondern als Erwartung an alle Angehörigen dieser
Fremdgruppe gerichtet werden kann" (
Schmalz-Jacobsen/Hansen
1997, 246 ff.).
 zum
Seitenanfang
zum
Seitenanfang