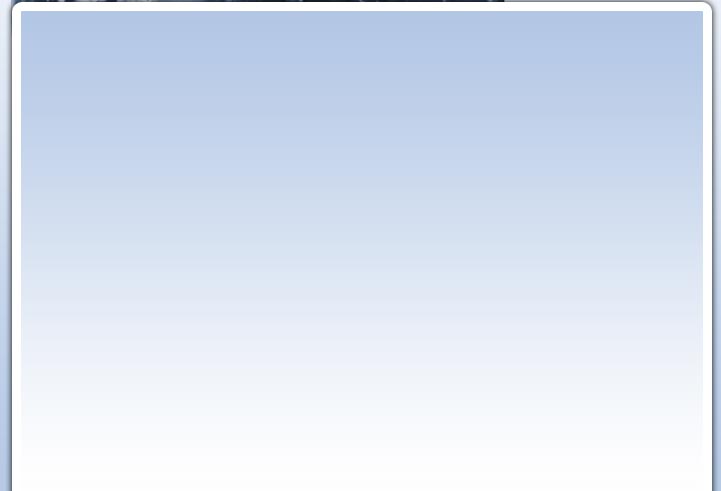Partizipation
Partizipation "… heißt übersetzt Beteiligung, Teilhabe,
Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung, Einbeziehung. In der Soziologie bedeutet
Partizipation die Einbindung von Individuen in Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse.
Wünschenswert sind vielfältige Partizipationsmöglichkeiten (Beteiligungsformen)
und eine hohe tatsächliche Partizipationsrate. Politisch gesehen gibt es
einen ganzen Theoriezweig der Partizipatorischen Demokratie, die versucht, die
politische Beteiligung zu maximieren und möglichst viele Bürger an
dem politischen Entscheidungsprozess teilhaben zu lassen. In der Betriebswirtschaft
bedeutet Partizipation die Beteiligung von Mitarbeitern an der Entscheidungs-
und Willensbildung einer hierarchisch höheren Ebene der Organisation"
(
Wikipedia
2004: Partizipation;
Internetquelle).
Generell unterscheidet die Literatur bis zu sieben Typen von Partizipation,
die von bloßer Information über die Mitwirkung an Entscheidungen
bis zur autonomen Selbststeuerung reichen (
Pretty
et al. 1995). Mit Hilfe partizipativer Ansätze und Methoden soll die
Bürgerbeteiligung bzw. im EZ-Kontext die politische Teilhabe von ›Zielgruppen‹
an Entscheidungsprozessen maximiert werden.
In der Bürgerbeteiligung des Nordens ist der Schritt von der formalen Bürgeranhörung
zu kommunikativen Beteiligungsformen z. B. mit folgenden methodischen Ansätzen
verbunden: Runde Tische / Foren; Zukunftskonferenz; Zukunftswerkstatt; Bürgergutachten/Planungszelle;
›Planning for Real‹ u. a. (vgl.
Stiftung
Mitarbeit 1998).
In der EZ reichen die Ansätze von RRA, PRA, über GRAAP zu DELTA und
werden inzwischen unter dem Label ›Participatory Learning Approaches‹
zusammengefasst (
Schönhuth/Kievelitz 1994
Pretty
et al. 1995). Allerdings lässt sich aus der Anwendung partizipativer
Methoden mit Zielgruppen noch kein Partizipationsanspruch ableiten. Eine Faustregel
zur einfachen Bestimmung der Partizipationsform lautet: ›Wer beteiligt
wen, wann, woran, in welcher Form und zu welchem Ziel‹ (vgl.
Schönhuth
2004c). Eine der wenigen Situationen, in denen die Partizipationsdiskurse
im Norden (Bürgerbeteiligung) und für den Süden (EZ-Ansätze)
in Deutschland zusammengeführt wurden, war der "Dare to Share Fair"
1995 in der GTZ (vgl.
Mabile
1995).
 Partizipation
in der EZ
Partizipation
in der EZ
 zum
Seitenanfang
Partizipation in der EZ
zum
Seitenanfang
Partizipation in der EZ
Die Begriffe ›Partizipation‹ und ›partizipatorisch‹ tauchten
Ende der fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts erstmals im Fachjargon
einzelner, eher selbstkritischer Entwicklungsexperten auf. Mit dem weitgehenden
Scheitern der Politik der ersten beiden Entwicklungsdekaden verloren die Begriffe
ihren subversiven Charakter. Bis in die Weltbankspitze wurde nun von der angemessenen
"Teilhabe" (participation) der Armen am Wachstum gesprochen (McNamara
1973, vgl.
Rahnema
1993b: 250). Partizipation wurde wahlpolitisch interessant, galt als effektivitätssteigernd
und als wirksames Argument für Spenden und Hilfsgelder.
In der internationalen EZ wurde noch bis weit in die 1990er Jahre Partizipation
von Zielgruppen in erster Linie als Mittel zur Erreichung vorher von Experten
definierter Ziele verstanden. Spätestens mit der zweiten Auflage der Weltbankpublikation
des Sozialwissenschaftlers Michael Cernea "Putting People First" von
1991 und dem drei Jahre später folgenden Partizipationshandbuch der Weltbank
(
World
Bank 1996) wurde eine programmatische Wende hin zu mehr aktiver Beteiligung
von Zielgruppen an Entwicklungsprojekten und -programmen sichtbar. Das darin
enthaltene
 Stakeholder-Prinzip
Stakeholder-Prinzip
forderte eindeutig dazu auf, primär die nicht organisierten, nicht artikulationsfähigen
Gruppen auf lokaler Ebene in die Entscheidungsfindungsprozesse von Projekten
und Programmen einzubinden. Zumindest formell wurde damit ein Wechsel hin zu
einem Konzept vollzogen, das Partizipation politisch verstand und dessen Ziel
letztlich eine Veränderung machtpolitischer Konstellationen zugunsten Benachteiligter
war. Mit der entwicklungspolitischen Konzeption des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) aus dem Jahr 1996 hat auch
die deutsche Bundesregierung diesen Anspruch festgeschrieben.
 Partizipationskonzept
Partizipationskonzept
Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei diesem Konzept weit auseinander. Heute
werden Formen instrumenteller Partizipation, wie die unverbindliche Konsultation
von Betroffenen oder materielle Anreize in food-for-work oder cash-for-work-Programmen
ebenso unter dem Begriff gefasst wie Ansätze, die auf von außen nur
noch finanziell oder logistisch unterstützte Selbstmobilisierungsprozesse
lokaler Gruppen setzen. Partizipation lässt sich begrifflich von jedem
einsetzen, andererseits aber praktisch äußerst schwierig einfordern,
überprüfen oder sanktionieren. Teilnahme und Teilhabechancen sind
bei diesem Begriff deshalb nur unscharf definiert. Im Grenzfall können
auch Zwangspartizipation in Massenveranstaltungen (von Einheitsparteien oder
Religionsgemeinschaften, Beispiele bei
Elwert
2002), Nepotismus (
Lauth
1999) oder Patron-Klientstrukturen (
 Patronage
Patronage;
z. B.
Teves
2000) als Partizipation bezeichnet und von den Beteiligten auch so empfunden
werden. Elwert plädiert deshalb dafür, eindeutig zur Verrechtlichung
von Partizipation zu stehen und Partizipation nicht als Ersatz für den
Rechtsstaat zu akzeptieren (
Elwert
2002). Partizipation in einem politischen Sinne bedeutet (mit)entscheiden.
Partizipation wäre deshalb gerade bei der Gestaltung von Länderprogrammen,
Schwerpunktstrategien und Projektentwürfen der EZ wichtig. Auch wäre
der mögliche Konflikt von nicht demokratisch legitimierter Partizipation
und formeller Demokratie (Kommunalparlament versus Bürgergruppen) im Auge
zu behalten (
 Zivilgesellschaft
Zivilgesellschaft;
vgl.
Bliss
2003). Ein nur schwer zu lösendes Problem ist die Partizipation dritter
entscheidungsrelevanter Gruppen, die nicht Zielgruppen eines Projektes, aber
in erheblichem Umfang in eine Maßnahme involviert sind (z. B. Holz verarbeitende
Betriebe im Kontext eines Waldschutzprojektes, Großgrundbesitzer in einem
Kleinbauernvorhaben, umweltverschmutzende Betriebe in einem Stadtteilsanierungsvorhaben
usw.). Da es sich hierbei z.T. um die Verursacher jener Probleme handelt, die
mit EZ-Unterstützung behoben werden sollen, kann Partizipation für
sie eigentlich nur Mitwirkung bei der Suche nach Lösungen, nicht aber eine
definitive Mitentscheidung beinhalten (vgl.
Schönhuth/Bliss
2001).
 zum
Seitenanfang
Partizipationskonzept
zum
Seitenanfang
Partizipationskonzept
Das deutsche Entwicklungsministerium BMZ hat 1999 in seinem Partizipationskonzept
partizipative Entwicklung als einen Prozess definiert, in dem die Menschen eine
aktive und maßgebliche Rolle bei allen Entscheidungen spielen, die ihr
Leben beeinflussen (
BMZ
1999b: 4). Das Partizipationskonzept ist eine entwicklungspolitische Vorgabe
für die Gestaltung der bilateralen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit
durch das BMZ und die durchführenden Organisationen. Den deutschen Nichtregierungsorganisationen
(NRO) soll es als Orientierungshilfe dienen. Es ersetzt die beiden Konzepte
"Soziokulturelle Kriterien für Vorhaben der Entwicklungszusammenarbeit"
von 1992 und das Sektorübergreifende Zielgruppenkonzept: "Die beteiligten
Menschen in der Entwicklungszusammenarbeit" von 1995.
In Anlehnung an die OECD/DAC-Richtlinien von 1995 wird partizipative Entwicklung
als Prozess definiert, in dem die Menschen eine aktive und maßgebliche
Rolle bei allen Entscheidungen spielen, die ihr Leben beeinflussen. Das vorliegende
Partizipationskonzept des BMZ befasst sich in erster Linie mit der partizipativen
Gestaltung der EZ, versteht Partizipation aber auch als ein eigenständiges
Ziel der EZ. Partizipation ist auch tragendes Prinzip der Armutsbekämpfung
sowie der Forderung nach gleichberechtigter Beteiligung von Frauen und Männern
am Entwicklungsprozess. Das Partizipationskonzept steht deshalb in engem Zusammenhang
mit den sektorübergreifenden Konzepten zur Armutsbekämpfung und mit
dem Gleichberechtigungskonzept (vgl.
BMZ
1999c;
Internetquelle).
 Gender
Gender.
Stets wird hierbei ein grundlegender Zusammenhang zwischen handlungsbestimmenden
kulturellen Prägungen und Entwicklung betont: "Für die Bewertung
und Umsetzung von Entwicklungszielen spielt Kultur eine herausragende Rolle,
denn die kulturellen Prägungen der Menschen bestimmen, was ihnen wertvoll
und erstrebenswert ist. Kultur ist außerdem Grundlage und Voraussetzung
für Innovation und Kreativität (...). In der Begegnung, im Austausch
und der gegenseitigen Beeinflussung der Kulturen, spielt die partizipatorische
EZ eine wichtige Rolle. Sie leistet damit einen Beitrag zum kulturellen Dialog"
(
BMZ 1999b;
Internetquelle).
Letztendlich steckt also in diesem Konzept, trotz der starken Stakeholder-Orientierung
und des offenen Partizipationsbegriffes noch ein essentialistisches Verständnis
von Kultur.
 zum
Seitenanfang
Patronage
zum
Seitenanfang
Patronage
Nach Beer bezeichnet Patronage einen "Austausch zwischen überlegenen
(Patron) und unterlegenen (Klient) Partnern, der meist asymmetrisch verläuft,
von den Beteiligten jedoch für lohnend gehalten wird. Der Patron verfügt
über Ressourcen und Macht, an denen der Klient teilhaben will. Er liefert
dafür einen Gegenwert in Form von Dienstleistungen, Gütern und/oder
Loyalität. Der Austausch ist nicht formal festgelegt, sondern basiert auf
der persönlichen Beziehung zwischen beiden Parteien. Patronageverhältnisse
werden aus wirtschaftlichen, politischen und religiösen Gründen eingegangen"
(
Beer 1999b:
284).
In den Philippinen z. B. treten Patron-Client-Beziehungen vor allem in der Institution
der ›geschuldeten Dankbarkeit‹ (›utang na loob‹) auf, die
in ein hierarchisches System wechselseitiger und oft lebenslänglicher,
nicht kontraktuell abgesicherter Beziehungen von Gunst und Verpflichtungen eingebunden
ist. Die Klienten nutzen dieses System als Netz zur Unterstützung und Hilfe
in Notzeiten. Neben den lokalen politischen Führern stellen auch andere
einflussreiche Gemeinschaftsmitglieder Ressourcen wie Darlehen und Kredite bereit,
oder sie verschaffen Zugang zu Patronen, die für die Bereitstellung bestimmter
strategischer Ressourcen wichtig sind. In Gemeindeentwicklungsprozessen wird
üblicherweise den lokalen politischen Führern die Projektverantwortung
zugewiesen. Diese tendieren in der Regel dazu, die Begünstigten von Projekten
aus ihrer eigenen Klientel, nach utang na-loob-Prinzipien auszusuchen. Auch
die Motivation von ›beneficiaries‹, in Programmen zu partizipieren,
hängt stärker an strategischen Entscheidungen innerhalb des utang-na-loob-Systems,
als externen Geldgebern und Experten bewusst ist. Ohne es zu wollen, werden
diese als moderne ›patrons‹ in das kulturelle System von Abhängigkeit,
geschuldeter Dankbarkeit und lebenslänglicher Verpflichtungen eingebunden
– mit all den daraus entstehenden Missverständnissen und Enttäuschungen
auf beiden Seiten (vgl.
Teves
2000).
 zum
Seitenanfang
Pattern
zum
Seitenanfang
Pattern
 Kulturmuster
Kulturmuster
 zum
Seitenanfang
Pluralismus, kultureller
zum
Seitenanfang
Pluralismus, kultureller
"Verschiedene Kulturen entwickeln unterschiedliche Lösungen für
gleiche oder ähnliche Probleme. Dies erzeugt den kulturellen Pluralismus,
wobei jede Kultur davon ausgeht, dass die von ihr gefundene Lösung die
natürliche und normale darstellt" (
Nicklas
1991: 130).
Der Begriff des kulturellen Pluralismus wurde 2002 von der UNESCO im Rahmen
der Deklaration zur Kulturellen Vielfalt in die internationale Entwicklungsdiskussion
eingeführt: "In unseren zunehmend vielgestaltigen Gesellschaften ist
es wichtig, eine harmonische Interaktion und die Bereitschaft zum Zusammenleben
von Völkern und Gruppen mit sehr unterschiedlichen, pluralen und dynamischen
kulturellen Identitäten sicher zu stellen. Nur eine Politik der Einbeziehung
und Mitwirkung aller Bürger kann den sozialen Zusammenhalt, die Vitalität
der Zivilgesellschaft und den Frieden sichern. Ein so definierter kultureller
Pluralismus ist die politische Antwort auf die Realität kultureller Vielfalt.
Untrennbar vom demokratischen Rahmen führt kultureller Pluralismus zum
kulturellen Austausch und zur Entfaltung kreativer Kapazitäten, die das
öffentliche Leben nachhaltig beeinflussen" (Artikel 2: Von kultureller
Vielfalt zu kulturellem Pluralismus;
UNESCO
2002b:
Internetquelle).
 zum
Seitenanfang
Politikdialog
zum
Seitenanfang
Politikdialog
Laut einer GTZ-Definition allgemein "... die Unterstützung von in
der Regel bilateralen Projekten und Programmen auf Regierungsebene über
die politischen Grundlagen und Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit. Der Politikdialog
soll die Voraussetzungen für partnerschaftliche Zusammenarbeit, aber auch
für die Durchsetzung von als notwendig erachteten Reformen schaffen (z.
B. Einhaltung der
 Konditionalitätskriterien
Konditionalitätskriterien).
In der deutschen EZ: Die deutsche Bundesregierung, vertreten durch das BMZ,
führt mit den Kooperationsländern einen partnerschaftlichen Dialog
über die Grundlagen sowie über aktuelle Fragen der Zusammenarbeit.
Dieser Politikdialog findet meist in Form von Regierungsverhandlungen, Regierungskonsultationen
und Arbeitsgesprächen statt. Er zielt vorrangig darauf ab, eine Übereinstimmung
beider Seiten hinsichtlich der Ziele und Schwerpunkte ihrer Entwicklungszusammenarbeit
herzustellen.
Grundlage des Politikdialoges und des Programms der Zusammenarbeit sind vom
BMZ erstellte sogenannte Länderkonzepte, welche die deutsche Position zu
den Schwerpunkten und zu den wesentlichen Inhalten der Zusammenarbeit festhalten
und auch auf partizipative Fragen eingehen" (
GTZ
o. J.; Die Begriffswelt der GTZ;
Internetquelle).
Auf der Ebene der Kooperationsländer legt die Bundesregierung Art und Umfang
der bilateralen fünf Kriterien fest: Partizipation der Bevölkerung
am politischen Prozess, Gewährleistung von Rechtssicherheit, Beachtung
der Menschenrechte, marktfreundliche und sozial orientierte Wirtschaftsordnung
und Entwicklungsorientierung des staatlichen Handelns. Oft ist mit Politikdialog
auch ›kritischer Dialog‹ gemeint, das heißt, es sollen problematische
Fragen von Governance, Gender usw. angesprochen werden.
 zum
Seitenanfang
Politische Kultur
zum
Seitenanfang
Politische Kultur
"Der Begriff ist amerikanischer Herkunft und wird in der Forschung wertfrei
benutzt. Im allgemeinen Sprachgebrauch hat sich dagegen in Deutschland eine
nur positive Verwendung des Begriffs durchgesetzt. Danach beinhaltet politische
Kultur einen besonders stilvollen oder moralischen Umgang mit politischer Macht,
den man einander zubilligen oder absprechen kann" (
Greiffenhagen/Greiffenhagen
2003).
Nach Schubert/Klein bezeichnet politische Kultur "...die konkrete Struktur
und die tatsächliche Wirkung der politischen Einrichtungen eines politischen
Gemeinwesens auf die Einstellungen und Werte, Forderungen und Leistungen der
Bürger und Bürgerinnen gegenüber diesen Einrichtungen sowie im
Gegenzug die (verantwortungsbewusste) Teilnahme der Bürger und Bürgerinnen
an diesen Einrichtungen (z. B. Einstellung gegenüber Radikalismus, Engagement
für sozialpolitische Einrichtungen, Wahlbeteiligung, persönlicher
Einsatz für die Grundrechte etc.). Umgangssprachlich bezeichnet Politische
Kultur den Stil der politischen Auseinandersetzung (Streitkultur)" (
Schubert/Klein
2001).
 zum
Seitenanfang
Populärkultur
zum
Seitenanfang
Populärkultur
Populärkultur (engl.: "popular culture") wird häufig im
Gegensatz zu Elite- oder
 Hochkultur
Hochkultur
gebraucht. Im engeren Sinne umfasst sie die Produkte der Kultur- und Unterhaltungsindustrie,
in einem weiteren Sinne die nicht streng nach sozialen Milieus unterschiedene
 Alltagskultur
Alltagskultur
des ›einfachen Mannes‹. Vor allem die Forschungsrichtung der
 ›Cultural
Studies‹
›Cultural
Studies‹ widmet sich der Untersuchung unterschiedlichster Bereiche
der Populärkultur als sozial konstruierte Kulturphänomene (von der
Verbreitung des Walkman bis zur Rolle der Formel 1 für die Massenfreizeitkultur).
Als Forschungsgegenstand existiert ›Populäre Kultur‹ seit über
40 Jahren. Dennoch ist weder verbindlich geklärt, welche Gegenstände
bzw. Aktivitäten dazugehören, noch, wie populäre Kultur zur Gesamtkultur
steht. Nach Hügel (
2003:
1 ff.) ist das Einzige, worüber Forschung und Teilnehmer an der populären
Kultur sich einig sind, dass sie "Spaß macht". Er plädiert
deshalb im Widerspruch zu den
 Cultural
Studies
Cultural
Studies auch dafür, die ästhetische Seite populärer Kultur,
ihre "Unterhaltungsfunktion " und damit die Differenz zur
 Alltagskultur
Alltagskultur
wieder stärker zu betonen. Populäre Kultur zeichne sich gerade durch
ihren nicht festgelegten "ambigen" sozialen und gleichzeitig ästhetischen
Charakter aus. Konzepte einer solchen Populärkultur umfassen neben der
Alltags-, Erlebnis- und Freizeitkultur auch die Jugendkultur,
 Kulturindustrie
Kulturindustrie,
die Massen- und die Volkskultur. Orte der Populären Kultur sind z. B. Ausstellungen,
Kino, Museum, Konzert, Stadion oder Zirkus (vgl.
Hügel
2003: 13 ff.)
 zum
Seitenanfang
Polyzentrismus
zum
Seitenanfang
Polyzentrismus
Polyzentrismus ist das "… Gegenteil von
 Ethnozentrismus
Ethnozentrismus:
Der Versuch, interkulturelle Handlungszusammenhänge nicht vor dem Hintergrund
der eigenkulturellen Erfahrungen zu interpretieren; Anerkennen der Eigenständigkeit
anderer Kulturen; Bereitschaft, kulturspezifische Wertungen zu relativieren"
(
Interkulturelle
Kompetenz Online:
Internetquelle).
 zum
Seitenanfang
Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP)
zum
Seitenanfang
Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP)
Mit der erweiterten Entschuldungsinitiative für die Highly Indebted Poor
Countries (HIPC II) der G7-Länder 1999 in Köln verbindet sich die
Verpflichtung der Regierungen, im Dialog mit der
 Zivilgesellschaft
Zivilgesellschaft
eine nationale Armutsminderungsstrategie zu erarbeiten und umzusetzen. Der Gegenwert
der dabei erlassenen Schulden sollte zugunsten der armen Bevölkerungsmehrheit
verwendet werden. Mit Hilfe der von den Ländern selbst zu erstellenden
"Poverty Reduction Strategy Papers" (PRSPs) sollte dabei neben der
eindeutigen Armutsorientierung der eingesetzten Mittel eine "Ownership"
der lokalen Regierungen bei der Erstellung und Umsetzung der Strategie, aber
auch aller zivilgesellschaftlich relevanter Gruppen und vor allem der Ärmsten
selbst erreicht werden.
Das Problem bei den PRSPs ist zum einen der Widerspruch zwischen "Ownership
und Donorship", d. h. die Tatsache, dass PRSPs einerseits als eigenständige
Strategiepapiere der betroffenen Länder konzipiert sind, sie aber anderseits
der Qualitätskontrolle ("approvement" bzw. inzwischen abgeschwächter
"endorsement") durch die Bretton-Woods-Institutionen und anderer teilweise
bilateraler Geber unterliegen (vgl.
Wollenzien
2004: 160). Auch wird vielfach kritisiert, dass der PRSProzess häufig
mit der Vorlage des fertigen Konzepts, d. h. noch vor der Implementierung abgebrochen
wird ("implementation gap"), und dass statt klar priorisierter und
operationalisierter Ziele häufig allgemeine "Wunschlisten" die
Strategiepapiere dominieren (vgl.
Bliss
2004).
Das vielleicht gravierendste Problem betrifft jedoch die Beteiligung der zivilgesellschaftlichen
Gruppen. Das Fehlen einer qualifizierten zivilgesellschaftlichen Mitwirkung
durch betroffene Armutsgruppen, aber auch legitimierter Massenorganisationen
("participation gap"), führt dazu, dass die Armutsanalyse auf
Symptomen stehen bleibt und die strukturellen Ursachen für Armut, d. h.
der Ausschluss von Teilen der Bevölkerung vom Zugang zu produktiven Ressourcen,
weitgehend ausklammert werden (vgl.
Bliss
2004). Hier wird sozial- und kulturwissenschaftlicher Sachverstand in zunehmendem
Maße wichtig werden, um diesen in vielen PRSPProzessen nicht wahrgenommenen
Gruppen überhaupt erst einmal zur Artikulationsfähigkeit zu verhelfen
("capacity to aspire",
Sen
2004).
 zum
Seitenanfang
Prägungen, kulturelle
zum
Seitenanfang
Prägungen, kulturelle
Der Begriff gibt die Vorstellung von im Wesentlichen unveränderlichen ›Prägungen‹
durch kulturelle Sozialisationsinstanzen (Eltern, Erzieher, Schule, Kirche,
Medien, Peergroups ...) wieder, denen das Individuum in der Phase des Hineinwachsens
in eine kulturelle Umgebung unterworfen ist (
 Enkulturation
Enkulturation).
Sie ist in den Kultur-Definitionen aller großen Entwicklungshilfegeber
(
 BMZ
/ staatliche EZ und Kultur
BMZ
/ staatliche EZ und Kultur;
 Mondiacult
Mondiacult),
aber auch in
 Organisationskulturtheorien
Organisationskulturtheorien
und in gängigen interkulturellen Managementtheorien (
 interkulturelles
Management
interkulturelles
Management;
 Kulturdimensionen-Modell
Kulturdimensionen-Modell;
 Kulturstandards
Kulturstandards)
zu finden. Sie legt einen statischen Kulturbegriff zu Grunde, der so heute weder
theoretisch noch empirisch mehr aufrechtzuerhalten ist.
 Kultur
Kultur;
 Kultur
als geschlossenes System
Kultur
als geschlossenes System;
 Kultur
als Fluxus
Kultur
als Fluxus;
 Primordialismus
Primordialismus
 zum
Seitenanfang
Primordialismus
zum
Seitenanfang
Primordialismus
Primordial heißt wörtlich ›von der ersten Ordnung, vom frühesten
Ursprung her, schon immer da gewesen‹. In diesem Konzept werden Verwandtschaft,
Religion oder Territorium als konstituierende Merkmale für die Ordnung
sozialer Beziehungen hervorgehoben. Die mit ihnen verbundenen ›Prägungen‹
gelten als ursprünglich an das Individuum gebunden und von ihm nicht willentlich
veränderbar (sog. "givens", vgl.
McKay
1982). Diese Prägungen seien der Angelpunkt für das Entstehen
von
 Ethnizität
Ethnizität.
Der primordialistische Ansatz ist mit dem
 Kugelmodell
Kugelmodell
einer statischen Kultur verbunden und erklärt nicht die modernen Kulturprozesse
im Rahmen von Migration und Globalisierung (
 Kultur
als Fluxus
Kultur
als Fluxus). Ihm steht der situationale Erklärungsansatz gegenüber,
der davon ausgeht, dass ethnische Symbole von Gruppen mobilisiert werden, um
soziale, politische und materielle Ressourcen in Konfliktsituationen mit anderen
Gruppen sicherzustellen (vgl.
Liebscher
1994;
Internetquelle).
Allerdings lassen sich nicht alle ethnischen Konflikte über divergierende
politische und ökonomische Interessen der Akteure erklären. Die Kritik
am radikalprimordialen bzw. radikalsituationalistischen Ansatz hat inzwischen
zu einer Synthese beider Ansätze geführt. Ethnizität wird jetzt
als ein durch Interessen gesteuertes Konstrukt verstanden, bei dem situationsspezifisch
und selektiv auf primordiale Attribute der ethnischen Identität zurückgegriffen
wird (vgl.
Orywal/Hackstein
1993: 596; vgl.
Liebscher
1994;
Internetquelle).
 Ethnizität
Ethnizität;
 Essentialismus
Essentialismus.
 zum
Seitenanfang
Projektarena
zum
Seitenanfang
Projektarena
Das in der Politikwissenschaft und der Politischen Anthropologie gängige
Modell der Arena, in der verschiedene Akteure (Individuen, Gruppen), von jeweils
unterschiedlichen Handlungslogiken geleitet, miteinander zu tun haben, wurde
von den Sozialanthropologen Olivier de Sardan und Bierschenk auf die Beschreibung
von Entwicklungsprojekten angewandt. Die in Projekten entstehenden Konflikte
führen sie darauf zurück, dass bestimmte, für Entwickler (développeurs)
selbstverständliche Vorstellungen wie Raum, Zeit, Reichtum, Armut, Partizipation
etc., nicht von den Entwickelten (développés) geteilt werden.
Auch werden Projekte von den NutzerInnen sehr selektiv angeeignet, d. h. sie
interessieren sich nur für bestimmte Elemente eines angebotenen Entwicklungspakets,
oder sie werden im Sinne eigener, vom Projekt nicht beabsichtigter Interessen
"umgewidmet".
Auch eine strategische Einbeziehung soziokultureller Faktoren im Vorfeld verhindert
nach Olivier de Sardan diese Prozesse der selektiven Aneignung und Umwidmung
nicht, da sie das notwendige und unbeabsichtigte Ergebnis des Ineinandergreifens
der in der Projektsituation aufeinander treffenden Handlungsrationalitäten
darstellten. Akteure innerhalb der Entwicklungskonfiguration sind in ihrer Rolle
eindeutig festgelegt und damit auch bestimmten Logiken und Handlungsrationalitäten
verpflichtet. Jeder Versuch, verschiedenen Rollenanforderungen und damit Regelsystemen
gerecht zu werden (also z. B. erfolgreicher Projektmanager und gleichzeitig
zielgruppennaher Berater zu sein) beinhaltet danach die Gefahr, in beiden Rollen
zu versagen (vgl.
Olivier
de Sardan 1995;
Bierschenk/Olivier
de Sardan 2000; für eine kurze Zusammenfassung der Argumente:
Hutter
1998).
Der Projektarena-Ansatz überlappt sich mit dem der
 Schnittstellenanalyse
Schnittstellenanalyse,
hat aber einen anderen, eher auf das "Spiel der Akteure" bezogenen
Analysefokus.
 zum
Seitenanfang
zum
Seitenanfang