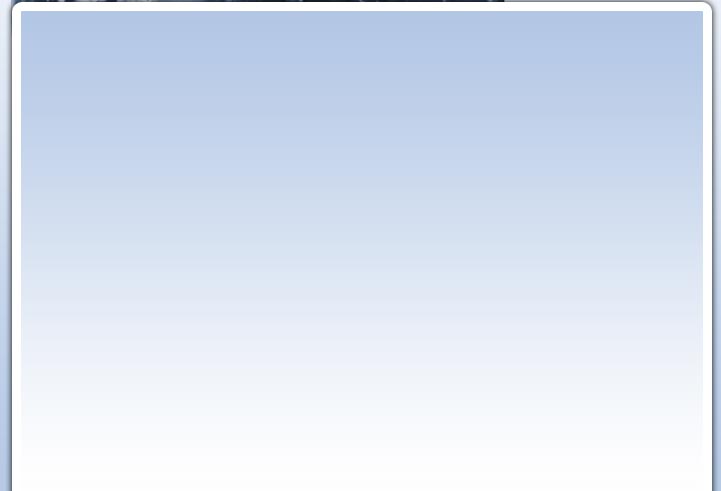Schema
"Kognitive Struktur, die Wahrnehmungen bzw. Wissen organisiert. Vermutlich
sind Schemata als Cluster organisiert. Man kann sich dies am Beispiel von Assoziationsketten
verdeutlichen: z. B. werden Assoziationen zum Begriff "Einsamkeit"
kulturell sehr unterschiedlich ausfallen und auch zu sehr unterschiedlichen
Assoziationsnetzwerken weiterleiten. Je differenzierter derartige Schemata ausgeprägt
sind, desto geringer ist die Gefahr einer stereotypengeprägten Weltsicht."
(
Interkulturelle
Kompetenz Online 2004;
Internetquelle)
 zum
Seitenanfang
Schnittstellenanalyse
zum
Seitenanfang
Schnittstellenanalyse
Die Schnittstellenanalyse baut auf dem Modell der
 Projektarena
Projektarena
auf. Sie konzentriert sich auf die Untersuchung der Prozesse an den Schnittstellen
zwischen den Akteuren (
 Stakeholder
Stakeholder)
in der Projektarena. Die Schnittstellenanalyse wurde von Norman Long zunächst
für die Untersuchung und Evaluierung entwicklungspolitischer Interventionen
entwickelt. Sie ist aber nach Dettmar auch geeignet, um das Zusammenwirken von
Machtstrukturen, historisch tradierten Symbolen, Zugehörigkeitsvorstellungen
und ökonomischen Interessen in interkulturellen Interaktionssituationen
allgemein zu untersuchen (vgl.
Dettmar
2000: 202; hier für ökonomische Interaktionen).
Eine soziale Schnittstelle ist nach Long "der kritische Punkt, an dem zwischen
verschiedenen sozialen Systemen, Feldern oder Ebenen der sozialen Ordnung aufgrund
unterschiedlicher normativer Werte und sozialer Interessen mit hoher Wahrscheinlichkeit
strukturelle Diskontinuitäten auftreten" (
Long
1993: 218). Teil der Schnittstellenanalyse ist es, zu untersuchen, "wie
diese Interaktionen von den sich jenseits der konkreten Schnittstellensituation
befindlichen Akteuren, Institutionen und Ressourcen beeinflusst werden und wie
diese Interaktionen wiederum die Akteure, Institutionen und Ressourcen jenseits
der Schnittstelle beeinflussen". (
Long
1993, 217 f.; vgl. auch
Arce/Long,
2000). Mikro- und Makroebene, divergierende Interessen, Handlungsorientierungen,
Lebenswelten und Verhaltensweisen unterschiedlich mächtiger Akteure greifen
an den Schnittstellen ineinander. Dabei bezieht die Analyse nach Long auch solche
Akteure mit ein, die zwar nicht anwesend sind, aber dennoch auf das System einwirken.
Während die differenztheoretischen interkulturellen Trainingsansätze
von Hofstede (
 Kulturdimensionen
Kulturdimensionen)
oder Alexander Thomas (
 Kulturstandards
Kulturstandards)
Konfliktursachen auf kulturelle Unterschiede zurückführen, interpretiert
die Schnittstellenanalyse kulturelle Unterschiede als Ergebnis von sozialen
und kulturellen Zuschreibungs- und Aushandlungsprozessen und als Ergebnis von
abgelaufenen Konflikten. Dies wird besonders dann relevant, "wenn AkteurInnen
kulturelle Zuschreibungen und Reifizierungen kultureller Differenz als Strategie
zur Durchsetzung ihrer Interessen instrumentalisieren" (
Schlamelcher
2003: 69;
 Kulturalisierung
Kulturalisierung).
Vor allem in neueren entwicklungsethnologischen und soziologischen Arbeiten
wird dieser theoretische Ansatz zur Untersuchung von konkreten Aushandlungsprozessen
an den Schnittstellen verstärkt verwendet.
Der Schnittstellenansatz ähnelt dem der
 Projektarena
Projektarena,
unterscheidet sich jedoch hinsichtlich des Analysefokus. Beim Arena-Begriff
liegt die Betonung auf dem gemeinsamen ›Spiel‹ (bzw. dem Kampf um
Einsätze und Preise). Der Schnittstellenansatz hebt dagegen auf die Tatsache
ab, dass sich die sozialen Akteure in vieler Hinsicht unterscheiden (Werte,
Interessen, Macht, Ressourcen). Das Konfliktpotential, das in beiden Konzepten
bedeutsam ist, liegt folglich im Arena-Ansatz in der Konkurrenzsituation strukturell
ähnlicher Partner, während es im Schnittstellenansatz im Interessenskonflikt
strukturell unähnlicher sozialer Akteure liegt (vgl.
Long
1993: 244; vgl. auch
Sodeik
1999).
 Aushandlungsraum
Aushandlungsraum;
 Kultur
als Fluxus
Kultur
als Fluxus
 zum
Seitenanfang
Selbst- und Fremdethnisierung
zum
Seitenanfang
Selbst- und Fremdethnisierung
Selbstethnisierung (selbstintendiertes Anderssein) ist der aktive Zugriff auf
ethnische Kategorien zur Selbstbeschreibung, meist über den Rückgriff
auf spezifische Identitätsmarker (Kleidung, Gesten, Bräuche, Symbole
etc.), die einen von anderen unterscheiden. Diese sind in der Regel als erfundene
Traditionen zu verstehen, die gerade dann wirksam werden, wenn dieser Akt der
Neuschaffung nicht zur Sprache kommen kann, sie damit als authentisch begriffen
und ausagiert werden. Selbstethnisierungsprozesse verweisen auf ein Gefüge
von Ausgrenzungen, Zuschreibungen, Projektionen und Interessen, das mit der
Gruppe, von der sich abgegrenzt werden soll, oft mehr zu tun hat als mit der
eigenen Herkunft, stellt Terkessidis (
1997)
z. B. für die Türken in Deutschland fest.
Fremdethnisierung ist ein sozialer Ausschließungsmechanismus, der Minderheiten
schafft, diese negativ etikettiert und dadurch Privilegien einer dominanten
Mehrheit zementiert (fremdintendiertes, d. h. durch eine dominante Gruppe definiertes
Anderssein).
 zum
Seitenanfang
Selbstbild / Fremdbild
zum
Seitenanfang
Selbstbild / Fremdbild
"Das eine existiert nur in Abhängigkeit vom anderen: Bei Definitionen
des Fremden kommen nicht ›objektive‹ Kriterien zur Geltung, sondern
die Einschätzung dieses Fremden in Bezug auf einen selbst. Unsere Beziehung
zum anderen entscheidet darüber, wie ›fern‹ oder ›fremd‹
es für uns ist. (...) Wir definieren uns immer im Verhältnis zu anderen
– und umgekehrt. (...) So können sich Selbsteinschätzungen in
Abhängigkeit zu unterschiedlichen Fremdbildern vollkommen verändern.
Das lässt sich an einem Beispiel gut vorstellen, wenn man überlegt,
wie sich z. B. ›wirtschaftliche Stärke‹ aus deutscher Perspektive
einerseits in Bezug auf die USA, andererseits in Bezug auf Mali definiert."
(
Interkulturelle
Kompetenz Online 2004;
Internetquelle).
 zum
Seitenanfang
Selbstkompetenz
zum
Seitenanfang
Selbstkompetenz
 Empowerment
Empowerment
 zum
Seitenanfang
Shared Culture
zum
Seitenanfang
Shared Culture
 Kultur
als abgeschlossenes System
Kultur
als abgeschlossenes System
 zum
Seitenanfang
Sinn
zum
Seitenanfang
Sinn
 Sinnsystem
Sinnsystem
 zum
Seitenanfang
Sinnkonzept
zum
Seitenanfang
Sinnkonzept
 Sinnsystem
Sinnsystem
 zum
Seitenanfang
Sinnsystem
zum
Seitenanfang
Sinnsystem
Sinn ist nach Jörn Rüsen (
1998)
als Fundamentalkategorie der kulturellen Weltorientierung und des Selbstverständnisses
des Menschen in seiner Lebenspraxis zu verstehen. Kollektive Sinnbildung führt
zur Ausbildung gemeinsamer Sinnsysteme.
Sinnsysteme bilden das tragende Gerüst gemeinsamer Ordnungserfahrung. Sie
stellen für die grundlegende Suche nach sinnvollen Erklärungen für
zentrale Lebensprobleme einen Satz elementarer Werte bereit, aus denen sich
orientierungs- und handlungsleitende Regeln ableiten lassen. Sinnsysteme begründen
die jeweilige Lebensweise, Gewohnheiten, Brauchtümer, Institutionen, Verhaltensnormen,
Anschauungen und Ideale einer Gemeinschaft, zu denen sich ihre Mitglieder bekennen
sollten. Ihre Begründungskriterien beziehen sie aus der Tradition, Überlieferung,
Geschichte und sich wandelnden Lebensbedingungen. (
 kulturelles
Gedächtnis
kulturelles
Gedächtnis) Ihre jeweiligen Ausdrucksformen besitzen einen kulturspezifischen
Zuschnitt. (vgl.
Müller-Ritz-Müller
2004: 161; 187f.)
Sinnsysteme erklären auch systemimmanente Widersprüche (z.B. zwischen
den Geschlechtern, zwischen sozialem Friedensgebot und legitimer Gewaltanwendung).
Gelegentliche Sinnbrüche sind mit dem Bezug auf das übergeordnete
Sinnsystem erklärbar. Buße und Opfer gleichen sie aus, "kitten"
(ms) sie. Sie sind jedoch durch schlimme Beliebigkeitserfahrungen, wie unbegreifliches
Leid oder Katastrophen erschütterbar. Diese werfen dann Letztbegründungsfragen
auf (warum gerade ich, wir, sie?) und führen so evt. zu Sinnkrisen (
Müller/Ritz-Müller
2004:11).
Während in Lokalgemeinschaften die Sinnsysteme früher vor allem durch
äußere Kontingenzerfahrungen bedroht wurden, traten mit Entstehung
der ersten
 Hochkulturen
Hochkulturen
unterschiedliche Sinnkonzepte miteinander gewaltsam in Konkurrenz. Die Siegreichen
übernahmen dann in der Regel auch die Deutungshoheit (vgl.
Müller/Ritz-Müller
2004:182). Mit den heutigen hochkomplexen, pluralistischen und nebeneinander
und gegeneinander agierenden Sinnsystemen büßen "die allgemeinen
Bezugs- oder Überbausysteme ihre Geltung bis auf vage Umrisse ein"
(
Müller/Ritz-Müller
2004:12). Formen von
 Identitätspolitik
Identitätspolitik,
strategischer und kultureller
 Essentialisierung
Essentialisierung
kommt dann eine wichtige Rolle zu.
Der eher soziologisch erklärend gebrauchte Begriff des "Sinnsystems"
überlappt sich mit dem eher philosophisch gebrauchten 'Weltbild.
 zum
Seitenanfang
Sinnwelt
zum
Seitenanfang
Sinnwelt
 Sinnsystem
Sinnsystem
 zum
Seitenanfang
Skript, kulturelles
zum
Seitenanfang
Skript, kulturelles
Der Begriff "kulturelle Skripte" (engl. cultural scripts) wurde von
Schank&Abelson (
1977)
im Rahmen der Erforschung künstlicher Intelligenz entwickelt. Sie können
nach Haller (
2004)
als Wissensstrukturen oder mentale Repräsentationen aufgefasst werden,
die einem Individuum zur Verfügung stehen, um Alltagssituationen zu bewältigen,
bzw. Tätigkeiten in einem konkreten kulturellen Kontext sinnvoll zu verrichten.
"Vereinfacht gesprochen sind kulturelle Skripte Regiebücher, die einem
Mitglied einer kulturellen Gruppe bestimmte Wahrnehmungspräferenzen und
Deutungsmuster vorgeben, und ihm einen Handlungsleitfaden für angemessenes
Verhalten an die Hand geben." (
Haller
2004;
Internetquelle).
Flechsig weist darauf hin, dass kulturelle Skripte eine wichtige Entlastungsfunktion
haben, "... denn man braucht nicht in jeder Situation immer wieder neue
Interpretations- und Verhaltensmuster zu entwickeln, sondern kann auf Routinen
zurückgreifen. Parallel dazu wird immer auch Hintergrundwissen aufbaut,
das dabei hilft, Situationen daraufhin zu interpretieren, welche Routinen/Skripte
sinnvollerweise ›angesagt‹ sind (›Meta-Routinen‹). Und schließlich
baut sich allmählich ein ›Weltbild‹ auf, ein kultureller Bezugsrahmen,
der es erlaubt, Ereignisse und Routinen, Hintergrundwissen und Meta-Routinen
zu ordnen. Bewusst werden diese Routinen, Meta-Routinen und Weltbilder in der
Regel erst, wenn Kontrasterfahrungen gemacht werden, d. h. wenn eine Person
feststellt, daß sie oder andere mit den erlernten kulturellen Skripten
nicht mehr weiterkommt" (
Flechsig
1996;
Internetquelle).
Als zentrale Aufgabe interkulturellen Trainings gilt nach Flechsig "die
Aneignung neuer kultureller Skripte, die in kulturell unterschiedlichen Kontexten
Gültigkeit besitzen. Im einfachen Falle geht es dabei um neue Skripte des
Begrüßens und der ›Etikette‹, die Respekt vor und Akzeptanz
von anderen Lebensgewohnheiten ebenso beinhalten wie die Aneignung neuer Wissenselemente
und Verhaltensmuster. Im komplexeren Fall ist interkulturelles Training integriert
mit längerfristiger Sprachaneignung und ausführlichen Landes- und
kulturkundlichen Studien" (
Flechsig
1996:
Internetquelle).
 zum
Seitenanfang
Social Analysis & Social (Impact) Assessment
zum
Seitenanfang
Social Analysis & Social (Impact) Assessment
Weltbankinstrumente, die auch im engeren Sinne soziokulturelle Sachverhalte
thematisieren. Social analysis beinhaltet Instrumente bzw. Methoden wie sozioökonomische
Umfragen, stakeholder analysis, Zielgruppenanalyse, partizipative Strategien,
Fallstudien, PRAs und social audits. Bei der "social analysis" geht
es darum, den soziokulturellen, institutionellen, historischen und politischen
Rahmen eines Projekts zu verstehen. Social assessment soll helfen, soziale Schlüsselthemen
und Risiken zu identifizieren und den Einfluss verschiedener Stakeholder vorherzusagen.
Es ist das Hauptinstrument des Partners für die adäquate Behandlung
der soziokulturellen Dimension ("social dimension") in weltbankgestützten
Operationen (vgl.
World
Bank 2006;
Internetquelle):
"The Bank’s instruments of social analysis include, at the macrolevel,
(1) Country/Macro Social Analysis done as economic and sector work (ESW) in
preparation for a Country Assistance Strategy (CAS), Poverty Reduction Strategy
Paper (PRSP), or to support policy formulation and sector strategies; and
(2) Poverty and Social Impact Analysis (PSIA), involving the analysis of the
distributional impact of policy reforms on the wellbeing of different stakeholder
groups, with a particular focus on the poor and vulnerable. At the projectlevel,
instruments of social analysis include,
(3) Project Social Analysis done during project appraisal to judge whether the
likely social benefits of an investment project justify Bank support; and
(4) Social Assessment, undertaken by the client for the purpose of incorporating
the views of stakeholders into the design of the project and establishing a
participatory process for implementation, monitoring and evaluation. Social
analysis methods/tools: include socioeconomic surveys, stakeholder analysis,
focus groups, participatory poverty assessments, beneficiary assessments, in-depth
case studies, participatory rapid appraisals, social audits" (
World
Bank 2003a)
 zum
Seitenanfang
Social Capital
zum
Seitenanfang
Social Capital
 Sozialkapital
Sozialkapital
 zum
Seitenanfang
Social Development
zum
Seitenanfang
Social Development
 Entwicklung,
soziale
Entwicklung,
soziale (Weltbankansatz)
 zum
Seitenanfang
Sozialindikatoren
zum
Seitenanfang
Sozialindikatoren
Nach Holtz "System statistischer Messgrößen, die, in regelmäßigen
Abständen erfasst, über soziale Sachverhalte informieren sollen, die
für die Qualität des Lebens in einer Gesellschaft von Bedeutung sind.
Die Forderung nach einer Berücksichtigung der Mehrdimensionalität
des Entwicklungsstandes ergab sich vor allem aus den Unzulänglichkeiten
des (eindimensionalen) Indikators ›Pro- Kopf-Einkommen‹, die ›Qualität
des Lebens‹ eines Landes zu erfassen. (...)
Beim UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) gibt es Bemühungen, ›Entwicklung‹
in mehreren Dimensionen zu erfassen. In dem 1990 erstmals von UNDP veröffentlichten
und zukünftig regelmäßig erscheinenden ›Bericht zur Lage
der menschlichen Entwicklung‹ wird ein ›Index der menschlichen Entwicklung‹
(Human Development Index-HDI) vorgestellt. Der HDI ist eine umfassende Messgröße
und schließt neben dem realen Einkommen auch die Lebenserwartung und den
Grad der Alphabetisierung ein. Die UNDP-Bestandsaufnahmen zu mehr als 170 armen
und reichen Ländern der Welt haben ergeben: So manche Länder mit durchaus
positiven Wirtschaftsdaten haben einen vergleichsweise schlechten Entwicklungsindex,
und einige Entwicklungsländer mit einem vergleichsweise niedrigen Pro-Kopf-Einkommen
weisen einen relativ hohen HDI-Rang auf." (
Holtz
2006).
Allerdings muss der HDI auch kritisch betrachtet werden. So haben die zentralasiatischen
Nachfolgestaaten der Sowjetunion extrem niedrige Einkommen (Tadschikistan z.
B. auf Niveau von Benin auf Platz 161), sind aber wegen der guten Bildungsdaten
50 Plätze im HDI höher positioniert. Das macht Vergleiche bzw. Ranglisten
zunehmend problematisch.
 zum
Seitenanfang
Sozialkapital
zum
Seitenanfang
Sozialkapital
Der Begriff wurde von Pierre Bourdieu (
1983)
geprägt und von James Coleman 1987 in die EZ eingeführt. Er bezeichnet
die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit der Teilhabe
an dem Netz sozialer Beziehungen gegenseitigen Kennens und Anerkennens verbunden
sind. Im Gegensatz zum
 Humankapital
Humankapital
bezieht sich das soziale Kapital nicht auf natürliche Personen, sondern
auf die Beziehungen zwischen ihnen. Die Beziehungen sind die eigentlichen Träger
dieser Kapitalform.
"In der amerikanischen Soziologie wurde das Konzept Anfang der 1990er Jahre
von Coleman und Putnam (
Putnam
1995) aufgenommen und soziales Kapital als Schlüsselmerkmal von Gemeinschaften
charakterisiert. (...) Soziales Kapital bietet für das Individuum einen
Zugang zu den Ressourcen des sozialen und gesellschaftlichen Lebens wie Unterstützung,
Hilfeleistung, Anerkennung, Wissen und Verbindungen bis hin zum Finden von Arbeits-
und Ausbildungsplätzen. (...)
Für die Gesellschaft verringert soziales Kapital Sozialkosten in dem Maße,
wie Hilfeleistungen und Unterstützung im Rahmen der Beziehungsnetzwerke
erbracht werden. Umgekehrt steigen die Kosten für Unterstützung und
Hilfeleistung für Kranke, Alte, Behinderte und sonst wie beeinträchtigte
Personen in dem Maße, wie in modernen Gesellschaften im Zuge der Individualisierung
und steigender Mobilität Beziehungsnetze wie Nachbarschaften, Freundeskreise,
Vereinsstrukturen usw. nicht mehr greifen. (...) Geringes soziales Kapital erhöht
somit die Transaktionskosten und verringert potentiell die Produktivität"
(
Wikipedia
2004;
Internetquelle).
Sozialkapital bezeichnet so im Kern ökonomisch relevante Attribute, die
die sozialen Beziehungen zwischen Individuen charakterisieren, die einer Gruppe
oder Netzwerken angehören: Vertrauen, Normen, soziale Verbundenheit, aber
auch das sozialen Beziehungen inhärente Informationspotential.
Braun und Kollegen halten 2000 im Rahmen eines ZEF-Diskussionspapieres kritisch
fest: "Eine verbesserte Kooperation durch Sozialkapital kann zu einer verantwortungsbewussteren
Nutzung öffentlicher Güter führen, zu einer schnelleren Verbreitung
von Innovationen beitragen und Transaktionskosten senken. Ein verbesserter Informationsfluss
sowie Vertrauen zwischen Marktteilnehmern kann wiederum zu wirtschaftlichen
Aktivitäten führen, die ohne die Existenz von Sozialkapital aufgrund
hoher Informations- und Kontrollkosten gar nicht durchgeführt würden.
(...) [Daher ist es für die Befürworter dieses Ansatzes im Rahmen
der EZ, wie etwa die Weltbank wesentlich,] vorhandenes Sozialkapital zu identifizieren
und Synergieeffekte zwischen Staat, privaten Unternehmen und gesellschaftlichen
Organisationen, z. B. bei der Bereitstellung öffentlicher Güter, zu
fördern. Ob allerdings internationale EZ besonders berufen ist, zur Bildung
von Sozialkapital beizutragen, das oft gruppen-, nationen- und standortspezifisch
ist, darf bezweifelt werden." (
von
Braun et al. 2000: 17; vgl. auch
Ostrom
1999).
Andere Autoren kritisieren den Sozialkapitalansatz wegen seiner depolitisierenden
Wirkung (
Harriss
2001) oder weil soziale Netzwerke im Gegensatz zu Kapital an Personen gebunden
sind, weshalb schon der Ausdruck "soziales Kapital" in die Irre führe
(
Arrow 1999).
 Wirtschaftsstil
Wirtschaftsstil
 zum
Seitenanfang
Soziokultur
zum
Seitenanfang
Soziokultur
Soziokultur bezeichnet heute im engeren kulturpolitischen Diskurs ein Praxisfeld
außerhalb der etatisierten Kultur im Überschneidungsbereich von Kultur-,
Bildungs-, und Sozialarbeit mit den Kernbereichen Stadtteilkulturarbeit, Kulturwerkstätten,
soziokulturelle Zentren (
Sievers/Wagner
1992: 17).
Der praxisorientierten Verwendung ging nach Behncke allerdings eine theoriegeleitete
Verwendung des Begriffes voraus, die zu definitorischen Unsicherheiten geführt
hat: Zum einen bezeichnete der Begriff ›soziokulturell‹ das aus der
Ethnologie in gesellschaftspolitische Diskurse der 1960er und 70er Jahre getragene,
alle Lebensbereiche umfassende Kulturverständnis (›alles ist Kultur‹).
Zum anderen wurde unter ›Soziokultur‹ im Nachgang der Debatte der
Frankfurter Schule eine Art Leitformel für die ›Neue Kulturpolitik‹
der deutschen Sozialdemokratie der 1970er Jahre verstanden. Als kritischer Gegenentwurf
zur etablierten Massenkultur (
 Kulturindustrie
Kulturindustrie)
verstand sich Soziokultur als selbstorganisierte, emanzipatorische Gegenkultur
außerhalb staatlicher Kulturinstitutionen (Theaterkollektive, Kulturfabriken,
Hausbesetzungen). Es ging um die ›Kulturalisierung und Politisierung des
Alltags‹ bei gleichzeitiger Veralltäglichung der
 Hochkultur
Hochkultur,
mit dem Ergebnis, dass ›Soziokultur‹ in einem emanzipatorischen Sinne
nicht mehr an bestimmte Schichten gekoppelt sein sollte. (
Behncke
2003: 61 f.)
Mit dem Niedergang der ›neuen sozialen Bewegungen‹ und dem Aufkommen
einer ›Politik der individuellen Lebensstile‹ in den 1990ern geriet
der Soziokulturbegriff allerdings in eine Legitimationskrise. "Die Institutionalisierung
der Soziokultur wird nun verstanden als ein Schritt der Rationalisierung von
der Selbstverwaltung zum Sozialmanagement, von der Wahrnehmung kulturpolitischer
Aufgabenstellungen wie ›Kultur für alle‹ zu einem kundenorientierten
Anbieter kultureller Dienstleistungen" (
Behncke
2003: 64;
Institut
für Kulturpolitik 2004).
Vor dem Hintergrund dieser Ökonomisierung von Soziokultur ist auch das
erwachte Interesse an
 Sozialkapital
Sozialkapital
als Planungsressource entwicklungs- und kulturpolitischer Maßnahmen zu
sehen. Die Rückkehr zur Idee der Nachbarschaftsnetzwerke (die "Kultur
in der Nachbarschaft"-Projekte der
 UNESCO
UNESCO)
oder die Forderung nach einem "Menschenrecht auf Kultur" (
Mercer
2002) sind interessante Versuche, Soziokultur in ihrem emanzipatorischen
Anspruch wieder zu beleben. Das gleichzeitige Arbeiten mit messbaren
 ›Kulturindikatoren‹
›Kulturindikatoren‹
im Rahmen kulturökonomischer Stadtplanungsprozesse (vgl.
Mercer
2002;
Matarasso
2001) steht allerdings in einem gewissen Widerspruch dazu.
 zum
Seitenanfang
Soziokulturelle Bedingungen
zum
Seitenanfang
Soziokulturelle Bedingungen
Laut Begriffswelt der GTZ: "Entwicklungsvorhaben stellen Interventionen
in komplexe soziokulturelle Systeme dar. Um die Berücksichtigung der kulturellen
und gesellschaftlichen Variablen, die bei der Konzeption und Durchführung
von Vorhaben eine Rolle spielen können, zu erleichtern, benennt das sektorübergreifende
Konzept "Partizipative Entwicklungszusammenarbeit" des BMZ drei sog.
Schlüsselfaktoren: Die soziokulturelle Heterogenität (ethnisch, religiös,
sozial ...), die Legitimität (bezogen auf Macht und Entscheidungsstrukturen,
die lokale Akzeptanz und die der Projektträger) und den Entwicklungsstand
bzw. die Kompatibilität oder gesellschaftliche Organisation (bezogen auf
die Anpassung im Sinne bester Nachhaltigkeit).
Die soziokulturellen Bedingungen sind insbesondere bei der Vorbereitung von
Vorhaben (Akteurs-/Zielgruppenanalyse, spezielle Studien) zu beachten, da der
nachhaltige Erfolg der EZ wesentlich von der Vereinbarkeit der geplanten Maßnahmen
mit den vorhandenen und noch mobilisierbaren Ressourcen und Möglichkeiten
abhängt. Ferner bilden sie das Gerüst der soziokulturellen Länderkurzanalysen,
die in die Länderkonzepte einfließen. Dabei ist die Partizipation
der Bevölkerung von großer Bedeutung. Bisweilen müssen kulturelle
Praktiken gegen die übergeordneten Ziele abgewogen werden: So müssen
Frauenrechte als Menschenrechte über gewohnheitsmäßige frauenfeindliche
Praktiken (wie z. B. der weiblichen Genitalverstümmelung) und historisch
oder religiös legitimierte Ungleichheit gestellt werden" (
GTZ,
o. J.;
Internetquelle).
 zum
Seitenanfang
Soziokulturelle Dimension
zum
Seitenanfang
Soziokulturelle Dimension
Der Ausdruck legt im Gegensatz zu den eher operationell und instrumentell aufgefassten
 soziokulturellen
(Schlüssel)faktoren
soziokulturellen
(Schlüssel)faktoren, die sich isoliert betrachten und behandeln
lassen, das Schwergewicht auf die Durchdringung aller Lebensbereiche mit Kultur.
Er ist verbunden mit dem Verständnis von
 Kultur
Kultur
als Rahmenbedingung, nicht als Interventionsfeld von EZ. Kritiker monieren allerdings
auch bei der soziokulturellen Dimension deren Instrumentalisierbarkeit im Rahmen
existierender EZ. Jenseits solcher eher grundsätzlicher Debatten werden
soziokulturelle Dimension und soziokulturelle Faktoren in handlungsrelevanten
Politik-Papieren häufig äquivalent gebraucht.
 zum
Seitenanfang
Soziokulturelle Faktoren
zum
Seitenanfang
Soziokulturelle Faktoren
 soziokulturelle
Dimension
soziokulturelle
Dimension;
 soziokulturelle
Schlüsselfaktoren
soziokulturelle
Schlüsselfaktoren
 zum
Seitenanfang
Soziokulturelle Heterogenität
zum
Seitenanfang
Soziokulturelle Heterogenität
Allgemein: "In Anlehnung an den Begriff der ökonomischen strukturellen
Heterogenität der Dependenztheoretiker, das gleichzeitige Neben- und Gegeneinander
aufeinander einwirkender und widersprüchlicher struktureller Bedingungen
im Bereich der sozialen Organisation, der Wertbestände und Normen einer
Gesellschaft an der Peripherie des modernen Weltsystems, so z. B. das in einem
Land anzutreffende Nebeneinander eines entwickelten modernen Sektors und eines
sog. traditionell rückständigen Sektors" (
Holtz
2006).
Im BMZ
 Schlüsselfaktoren
Schlüsselfaktoren-Konzept
ist soziokulturelle Heterogenität eine der drei Schlüsselfaktoren
neben ›Entwicklungsstand‹ und
 ›Legitimität‹
›Legitimität‹.
Soziokulturelle Heterogenität erfasst in einem Land oder einer Projektregion
die verschiedenen ethnischen, religiösen, sozialen und ökonomischen
Gruppen (einschließlich Verwandtschaftsgruppen) und Verbände sowie
deren Beziehungen zueinander, um u.a. benachteiligte Gruppen als potentielle
Zielgruppen der EZ zu identifizieren und ihre Partizipation sicherzustellen.
 zum
Seitenanfang
Soziokulturelle Kurzanalysen
zum
Seitenanfang
Soziokulturelle Kurzanalysen
Die seit Anfang der 1990er Jahre vor allem vom Überseeinstitut in Hamburg
im Auftrag des BMZ angefertigten soziokulturellen Länderkurzanalysen fallen
unter "relevante nationale und internationale Armutsstudien" und sollen
als Entscheidungs- und Planungsgrundlage für Projekt- und Länderkonzeptionen
dienen. Sie werden allerdings als Instrument im Rahmen des
 Politikdialogs
Politikdialogs,
in Länderkonzepten oder der Projektplanung bisher so gut wie nicht eingesetzt.
Ihre Wirksamkeit ist insgesamt marginal einzuschätzen und wird auch nicht
z. B. im Rahmen eines Wirkungsmonitorings überprüft. Ihr Fortbestehen
ist fraglich.
 zum
Seitenanfang
Soziokulturelle Schlüsselfaktoren
(SKF)
zum
Seitenanfang
Soziokulturelle Schlüsselfaktoren
(SKF)
Ende der 1980er schlug der BMZReferent Uwe Simson dem BMZ das Schlüsselfaktoren-Konzept
vor. Simson ging von dem "Wollen" und "Können" der
Betroffenen aus, zwei Punkte, die er als
 "Legitimität"
"Legitimität"
(Wollen) und "Entwicklungsstand" (Können) bezeichnete. Als quer
liegendes Kriterium fügte er die
 "soziokulturelle
Heterogenität"
"soziokulturelle
Heterogenität" hinzu, um die Aufmerksamkeit der Planer auf
Reichweite, Grenzen und potentielle Konflikte um das Projekt hinzuweisen. Zur
Operationalisierung wurde ein Wegweiser mit 53 Punkten entwickelt (
Müller
et al. 1991,
Müller
1996;
 Kulturindikatoren
Kulturindikatoren;
 Kernkultur
Kernkultur),
der jedoch bei der GTZ auf Ablehnung stieß, da er die Berücksichtigung
soziokultureller Aspekte nicht garantierte und sich die soziokulturelle Dimension
in ihrer Vielfalt sowieso kaum in einzelne Punkte packen ließe.
Der Begriff "Entwicklungsstand" wurde wegen seiner engen Verbindung
mit dem Konzept der "nachholenden Entwicklung" kritisiert. Daher schlagen
Bliss
et al. 1997 vor, ihn durch
 Kompatibilität
Kompatibilität
zu ersetzen. In einem Arbeitspapier für die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) 2003 erweitern Bliss und König den Begriff Kompatibilität um
die "Gesellschaftliche Organisation". Sie erfasst gesellschaftliche
Organisationsformen sowie Steuerungsprinzipien und -kapazitäten. Sie bezieht
sich insbesondere auf die organisatorischen und ökonomischen Möglichkeiten
der Zielgruppen, d. h. es geht um die Frage, wie die EZ gestaltet sein muss,
um optimal an diese Organisation der Zielgruppen angepasst zu sein (Aspekt der
Nachhaltigkeit). (nach
Bliss/König
2003;
Internetquelle)
 zum
Seitenanfang
Soziokulturelles Rahmenkonzept
zum
Seitenanfang
Soziokulturelles Rahmenkonzept
Übersektorales Rahmenkonzept des BMZ von 1992, das auf dem Konzept der
 soziokulturellen
Schlüsselfaktoren
soziokulturellen
Schlüsselfaktoren aufbaut und 1999 in das
 Partizipationskonzept
Partizipationskonzept
des BMZ eingegangen ist.
 zum
Seitenanfang
Sozioökonomische Kurzanalysen
(SÖK)
zum
Seitenanfang
Sozioökonomische Kurzanalysen
(SÖK)
"Ein von der GTZ und der KfW gemeinsam verantwortetes und mit der jeweils
anderen Organisation abgestimmtes Hintergrundpapier, mit dem beide Organisationen
dem BMZ ihre Vorstellungen hinsichtlich der länderbezogenen Schwerpunktbildung
näher bringen und so die Länderstrategie des BMZ beeinflussen können.
Darüber hinaus bieten die SÖK der GTZ Gelegenheit, ihre Erfahrungen
und Vorstellungen zur Gesamtkonzeption der Zusammenarbeit mit einem Land zu
artikulieren." (
GTZ
o. J.;
Internetquelle)
 zum
Seitenanfang
Stakeholder
zum
Seitenanfang
Stakeholder
Personen, Gruppen oder Institutionen (Akteure), die an Prozessen direkt beteiligt
sind, an ihnen Interesse haben und/oder von ihnen betroffen sind. Der Begriff
umfasst neben den bisherigen Zielgruppen oder ›Beneficiaries‹ auch
deren gesamtes Umfeld und Interaktionspartner, aber auch alle anderen von der
Intervention oder ihren Auswirkungen positiv oder negativ tangierten Akteure.
›Primary Stakeholder‹ sind die nicht organisierten, nicht artikulationsfähigen
Gruppen in der
 Projektarena
Projektarena,
denen in diesem Ansatz das besondere Interesse gelten soll.
 zum
Seitenanfang
Stamm
zum
Seitenanfang
Stamm
Nach Helbling ein politischer Verband sprachlich und kulturell verwandter Gruppen,
die ein gemeinsames Territorium besiedeln und nach einem genealogischem Prinzip
(Stammbaum) miteinander verbunden sind. Sie beachten gewisse Rechte und Pflichten
(Konfliktregelung, Kompensationszahlung) und können sich zur Verteidigung
des beanspruchten Lebensraums zusammenschließen. Ihre Fähigkeit zur
Integration, ihre kulturelle Homogenität, territoriale Abgegrenztheit und
identitätsstiftende Bedeutung wurde jedoch die längste Zeit von der
Forschung überbetont (
Helbling
1999: 354).
Nach der Definition der englischen Kolonialverwaltung war ein Stamm ("tribe")
eine durch Abstammung verbundene Bevölkerungsgruppe mit gemeinsamer Sprache
und Kultur, die auf einem bestimmten Territorium lebt und in der Regel von einem
Häuptling regiert wird. Jeder Mann gehört nur einem "Tribe"
an. Frauen werden zum "Tribe" des Mannes gerechnet. Für Afrika
konnte inzwischen belegt werden, dass es sich bei dieser Kategorisierung in
den meisten Fällen um eine koloniale Erfindung handelte, die es so vor
der Zeit der Kolonialverwaltung nicht gab. Vielfach haben sich Stämme erst
im Rahmen der Staatenbildung herausgebildet. (
Fried
1967;
Lentz
1998 am Beispiel von Ghana)
Der bekannteste Fall ist Ruanda, wo die später so verheerende personenbezogene
Kategorisierung in Tutsi, Hutu (und Twa-Pygmäen) erst durch die Einführung
von Identitätskarten durch die belgische Kolonialverwaltung in den 1930ern
fixiert wurde. Vorher waren diese Kategorien z. B. beim Wechsel der Wirtschaftsform
(vom feldbauenden Hutu zum viehzüchtenden Tutsi) für Individuen durchaus
wechselbar. Lentz resümiert für die afrikanische Situation am Beispiel
Nord-Ghanas: "Man wird eher in Bildern von Netzwerken und Clustern, Zentren
und Peripherien denken müssen. Mobilität, überlappende Netzwerke,
multiple Gruppenmitgliedschaften und kontextabhängige Grenzziehungen"
prägen das Bild (
Lentz
1998: 629).
Der Begriff Stamm wurde inzwischen von dem der
 ethnischen
Gruppe
ethnischen
Gruppe abgelöst. Teilweise wird er zur Bezeichnung von Untersegmenten
von Ethnien jedoch noch gebraucht (z. B. Afghanistan). Wie die ethnischen Gruppen
sind aber auch dort Stämme kaum als ›reale‹ soziopolitische Einheiten
greifbar, die gemeinsam handlungsfähig wären. Eher sind sie als ordnende
Kategorien zur kognitiven Strukturierung einer größeren Gesellschaft
zu verstehen (vgl.
Glatzer
2003: 89).
 zum
Seitenanfang
Stereotype
zum
Seitenanfang
Stereotype
Stereotype sind "verhärtete" Schemata, mit denen Menschen wahrgenommene
Eindrücke, Bilder etc. einordnen und damit ihr Gedächtnis entlasten
und Entscheidungsprozesse beschleunigen. Stereotype dienen also der kognitiven
Erleichterung. Oft sind sie mit dem Bestreben, zu statushohen Gruppen dazuzugehören,
verknüpft und dienen so der positiven Selbstabgrenzung (Quelle:
Interkulturelle
Kompetenz Online 2004;
Internetquelle).
Stereotype, die Realität und Komplexität vereinfachen, haben nach
Wille durchaus eine positive Funktion: Sie dienen dazu, unbekannte und unvertraute
Informationen unserem Denkapparat problemlos zugänglich zu machen und demzufolge
Handlungsfähigkeit in komplexen Situationen zu gewährleisten. Auch
beinhalten die meisten Stereotypen ›ein Fünkchen Wahrheit‹. Statistiken
können zeigen, inwieweit Stereotypen von der Wirklichkeit abweichen oder
nicht. Das Stereotyp vom Bier trinkenden Deutschen und vom Wein trinkenden Franzosen
stimmt z. B. mit den jeweiligen Spitzenplätzen im europäischen Vergleich
tatsächlich überein (vgl.
Wille
2003: Stereotype;
Internetquelle).
Man unterscheidet generell zwischen Autostereotyp (Selbstbild) und Heterostereotyp
(Fremdbild). Das Autostereotyp spielt bei der Nationenbildung (
 Nation
Nation)
und allgemeiner bei der Bildung
 kollektiver
Identität
kollektiver
Identität eine wichtige Rolle. Auch der
 Ethnozentrismus
Ethnozentrismus
beruht maßgeblich auf Stereotypenbildung.
 zum
Seitenanfang
Stigmatisierung
zum
Seitenanfang
Stigmatisierung
Ein Stigma ist der Sonderfall eines sozialen Vorurteils gegenüber bestimmten
Personen, durch das diesen negative Eigenschaften zugeschrieben werden. Es beruht
auf Verallgemeinerungen von teils selbst gewonnenen, teils übernommenen
Erfahrungen, die nicht mehr überprüft werden. Stigmatisierung heißt
dann ein verbales oder nonverbales Verhalten, das aufgrund eines zu Eigen gemachten
Stigmas jemandem entgegengebracht wird. Stigmatisierte sind Personen oder Gruppen,
denen ein bestimmtes meist negatives Merkmal oder mehrere Merkmale zugeschrieben
werden. (vgl.
Hohmeier
1975)
Erving Goffman hat den Begriff bereits zu Beginn der 1960er Jahre in die Gesellschaftswissenschaften
als Form einer "beschädigten sozialen Identität" eingeführt
(
Goffman
1967).
 zum
Seitenanfang
Stilforschung, kulturelle
zum
Seitenanfang
Stilforschung, kulturelle
Die kulturelle Stilforschung beschäftigt sich mit der Frage, ob nationale
Wissenschaftskulturen auch unterschiedliche wissenschaftliche Schreib- und Argumentationsstile
entwickeln, d. h. ob es ähnlich wie bei Fachsprachen (Fachkulturen) kulturspezifische
Varianten bzw. eine Nationalcharakteristik des Schreibstils gibt.
So versuchte z. B. der norwegische Sozialwissenschaftler Johan Galtung seine
Beobachtungen und Erfahrungen in und mit anderen Kulturen in einer Typologie
der ›intellektuellen Stile‹ in unterschiedlichen Wissenschaftskulturen
zu systematisieren (vgl.
Galtung
1981). Dem ›teutonischen‹ Wissenschaftsstil, dessen Zentrum er
in Deutschland und dessen Peripherie er in Osteuropa sieht, misst er z. B. Strenge
und Humorlosigkeit der Präsentation und eine Polarisierung im Sinne des
›Entweder – Oder‹ zu. Den sachsonischen Stil (USA, GB als Zentren)
hält er unter anderem für faktenorientiert, empirisch, humorvoll und
pragmatisch.
Auch wenn Galtung für seine aus seiner subjektiven Erfahrung abgeleitete
und außerordentlich hypothetisch argumentierende Darstellung aus Wissenschaftskreisen
stark kritisiert wurde (vgl. z. B.
Bolten
1999a,
2002),
hat er systematischer angelegte Studien in der Folge maßgeblich beeinflusst.
 zum
Seitenanfang
Streitkultur
zum
Seitenanfang
Streitkultur
 Politische
Kultur
Politische
Kultur
 zum
Seitenanfang
Subkultur
zum
Seitenanfang
Subkultur
"Eine Subkultur (›Unterkultur‹) bezeichnet in der Soziologie
eine bestimmte Untergruppe (Teilmenge) einer Kultur, deren grundsätzlichen
Werte und Normen die Mitglieder der Subkultur teilen. Die verschiedenen subkulturellen
Gruppierungen einer Kultur unterscheiden sich durch sekundäre kulturelle
Elemente voneinander.
Ein typisches Beispiel für Subkulturen sind die sozialen Klassen. Die Mitglieder
jeder sozialen Klasse (z. B. Bourgeoisie, Proletariat) kultivieren eigene Werte,
Normen und Verhaltensweisen, über die sie sich von der restlichen Kultur
differenzieren, ohne jedoch die grundsätzlichen kulturellen Werte und Normen
der dominanten Hauptkultur infrage zu stellen (
 Gegenkultur
Gegenkultur).
Andere Beispiele finden sich in den so genannten Jugendkulturen. Diese unterscheiden
sich oft über Kleidung, Musik und bestimmte Verhaltensweisen von der sie
umgebenden Hauptkultur, ohne diese jedoch grundsätzlich infrage zu stellen
(
 Habitus
Habitus;
dagegen:
 Gegenkultur
Gegenkultur)".
Literatur: Rolf Schwendter: Theorie der Subkultur. Hamburg. (Quelle:
Wikipedia
2004: Subkultur;
Internetquelle).
 zum
Seitenanfang
Synkretismus
zum
Seitenanfang
Synkretismus
"Religionswissenschaftliche Bezeichnung für die Vermischung von Elementen
aus unterschiedlichen Religionen, die bei der Anpassung einer Religion an eine
fremde Kultur entsteht oder Teil eines allgemeinen kulturellen Wandels ist und
zur Veränderung einer bestehenden Religion oder zu völlig neuen Synthesen
führt" (
Krech
1994: 660).
 zum
Seitenanfang
zum
Seitenanfang