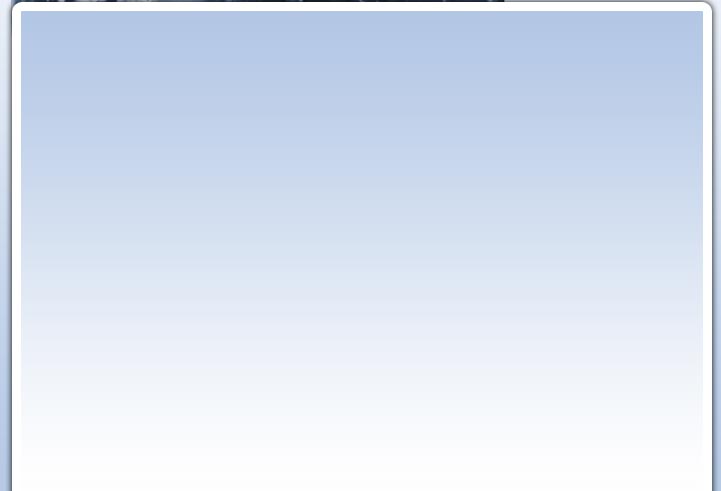Oberflächen / Tiefenstruktur
Kulturen verfügen nach Ansicht vieler Kommunikationsforscher über
eine sogenannte Oberflächenstruktur, die wahrnehmbar ist, wie etwa Gebäude,
Riten oder auch die Sprache (sog. "Perceptas"= wahrnehmbare Strukturen).
Die Tiefenstruktur liefert das dahinter liegende Konzept, die in der betreffenden
Kultur bekannten Bedeutungen und Interpretationen des Wahrnehmbaren (das Wertesystem
oder die "Conceptas").
 Eisbergmodell
Eisbergmodell
(
Wille 2003:
Oberflächen/Tiefenstruktur;
Internetquelle).
 zum
Seitenanfang
Oral tradition
zum
Seitenanfang
Oral tradition
 Tradition
Organisationskultur
Tradition
Organisationskultur
Die klassische betriebswirtschaftliche Perspektive geht davon aus, dass Organisationskultur
eine steuerbare Unternehmensvariable ist, die vom Management als Instrument
zur Effizienzsteigerung genutzt werden kann (›die Organisation hat eine
Kultur‹). Der interpretative Ansatz (›die Organisation ist eine Kultur‹)
betrachtet Organisationskultur eher als "ein implizites Phänomen;
in ihm bündeln sich die Denkfiguren, Hintergrundüberzeugungen, Wertvorstellungen,
Handlungsmuster usw., die sich im Laufe der Zeit im Umgang mit Problemen aus
der Umwelt und der internen Koordination herausgebildet haben und bewusst oder
unbewusst kultiviert und weitergegeben werden" (Schreyögg 1999; cit.
in
Wille 2003;
Organisation;
Internetquelle).
Sie kann deshalb nicht direkt erfasst werden.
Der interpretative Ansatz untersucht deshalb
 Kulturfelder
Kulturfelder,
kultureller
 Prägungen
Prägungen
primärer Art (ethnische Herkunft, Nationalität, Religion, Schichtzugehörigkeit,
sogenannte "cultural blueprints";
Wheelan
1994) und sekundärer Art (funktionale Gruppen, Hierarchieebenen =
 Subkulturen
Subkulturen),
wie sie aus der Sicht der Organisationsmitglieder selbst wahrgenommen und erfahren
werden.
Postmodernisten bezweifeln am ›homogenen‹ Organisationskulturansatz
allerdings das Konzept der Tiefe – also die Annahme, dass Organisationskultur
ein vorbewusstes und tief verankertes Konstrukt in den ›Köpfen‹
der Mitglieder ist – die Homogenität und den überdauernden Konsens.
Postmoderne Organisationskulturdefinitionen betonen die lose Verbindung von
Individuen.
 zum
Seitenanfang
Orientierungen, kulturelle
zum
Seitenanfang
Orientierungen, kulturelle
Der Begriff ›Orientierung‹ bezieht sich nach Flechsig ursprünglich
auf die räumliche Orientierung des Menschen. "Er weiß, wo er
sich im (dreidimensionalen) Raum befindet, er kennt also seinen Standort und
seine Lage in diesem Raum und hat Vorstellungen über die Beschaffenheit
der Umwelt, in der er sich befindet. Hat er sich verirrt, versucht er dann,
sich zu orientieren, also herauszufinden, wo er sich befindet und wie er sich
in seiner Umwelt bewegen kann."
Der Begriff ›kulturelle Orientierung‹ überträgt diese Vorstellung
von der Orientierung im dreidimensionalen Raum auf die Position des Menschen
im Hinblick auf kulturelle Bezugssysteme. Mit zunehmender gesellschaftlicher
Ausdifferenzierung wird danach auch der ›kulturelle Raum‹ vieldimensionaler.
"Jemand kann sich dann als Europäerin und Katholikin, Ärztin
und Feministin, Seniorin und Sozialistin, Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland
und Hessin zugleich verstehen. Und sie kann von anderen zu Recht oder zu Unrecht
diesen Bezugsgruppen zugeordnet werden. Welche Kombinationen dabei häufiger
oder weniger häufig vorkommen, in welchen Situationen welche Bezugssysteme
sich manifestieren und welche Entwicklungen Menschen im Laufe ihres Lebens machen,
verweist auf empirisch zu ermittelnde Tatbestände. Anders ausgedrückt,
›kulturelle Identität‹ von Menschen in modernen Gesellschaften
ist ein komplexer Sachverhalt, da kulturelle Orientierungen sich auf eine Vielzahl
kultureller Bezugssysteme richten. (...)
Das Bedürfnis oder die Notwendigkeit bewusster kultureller Orientierung
entsteht vor allem bei Begegnung und Kontakten mit Menschen anderer kultureller
Orientierung oder in ›fremden‹ kulturellen Kontexten. Fremdheitserfahrung
löst dann häufig auch die Frage oder die Suche nach ›eigenen‹
kulturellen Orientierungen aus." (
Flechsig
2001;
Internetquelle).
Flechsig schlägt eine Operationalisierung der Kategorien und Indikatoren
vor, die sich mit den Einstellungen von Menschen (z. B. Umwelt und zu der Möglichkeit,
diese zu kontrollieren, zu Phänomenen von Zeit wie Vergangenheit, Gegenwart,
Zukunft, Pünktlichkeit und Gleichzeitigkeit), mit Kommunikationsformen
und Kommunikationsstilen beschäftigen (ob man offen und direkt oder höflich
und indirekt kommuniziert, ob man Emotionen zeigt oder rein sachbezogen argumentiert).
Im Gegensatz zu kulturessentialistischen Ansätzen betont er jedoch, dass
Menschen hinsichtlich ihrer kulturellen Orientierungen nicht grundsätzlich
festgelegt seien, dass sie sich im Laufe des Lebens verändern, dass sie
schließlich von den Akteuren situationsbezogen und flexibel gehandhabt
werden.
 Kultur
als Fluxus
Kultur
als Fluxus
 zum
Seitenanfang
Othering
zum
Seitenanfang
Othering
Der Begriff Othering (von engl. other = "andersartig" mit der Endung
-ing", um das Substantiv bzw. Adjektiv zu einem handelnden Verb zu machen)
beschreibt den Gebrauch von und die Distanzierung oder Differenzierung zu anderen
Gruppen, um seine eigene ›Normalität‹ zu bestätigen. Im
Deutschen könnte man es transitiv mit "jemanden anders(artig) machen"
bzw. "Veranderung" übersetzen. Der Begriff wurde ursprünglich
von Gayatri Spivak geprägt für den Prozess, durch den der imperiale
Diskurs die Anderen bzw. "das im Machtdiskurs ausgeschlossene Andere"
kreierte (
Spivak
1985).
Othering beschreibt den Prozess, sich selbst bzw. sein soziales Image positiv
hervorzuheben, indem man einen anderen bzw. etwas anderes negativ brandmarkt
und als andersartig, das heißt ›fremd‹ klassifiziert, sei es
wegen der Rasse, der geographischen Lage, der Ethik, der Umwelt oder der Ideologie.
In dieser Differenzierung liegt potenzielles hierarchisches und stereotypisches
Denken, um seine eigene Position zu verbessern und als richtig darzustellen.
Othering ist somit ein Akt, sich mit anderen zu vergleichen und zur gleichen
Zeit sich von ihnen zu distanzieren, wobei man meint, dass Menschen und Gesellschaften,
deren Leben und historische Erfahrungen von den eigenen abweichen, sich von
den eigenen unterscheiden (was wahr ist) und nicht verständlich oder minderwertig
sind (was nicht wahr ist). Man befürchtet außerdem, dass sich fremde
Einflüsse auf die eigene Kultur ausweiten und sie damit bedrohen könnten.
Bezeichnet sich eine Gruppe als ›von Gott ausgewählt‹, grenzt
sie sich von den nicht Erwählten ab, geht aber auch das Risiko ein, von
den anderen untergraben zu werden (vgl.
Wikipedia
2004: Othering;
Internetquelle).
 Ethnozentrismus
Ethnozentrismus
 zum
Seitenanfang
zum
Seitenanfang